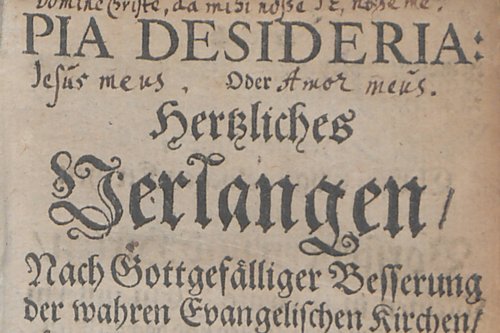100 Jahre württembergische Kirchenverfassung

Regelwerk bestimmt bis heute den Charakter der Landeskirche
Sie wird 100 - und ist für ihr Alter noch sehr rüstig: Am 24. Juni 1920, dem Geburtstag des württembergischen Reformators Johannes Brenz, wurde im Stuttgarter CVJM-Haus, der heutigen Furtbachklinik, die Verfassung der württembergischen Landeskirche verkündet. Diese Verfassung bestimmt – mit einigen zeitgemäßen Änderungen – bis heute die äußere Gestalt der Landeskirche.

Das Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Abtreten der Monarchien in Deutschland bewirkt. König Wilhelm II. von Württemberg verzichtete nicht nur auf die Krone, sondern trat auch als Oberhaupt der evangelischen Kirche des Landes zurück. Diese „Staatsumwälzung“ machte damit die Erarbeitung neuer Verfassungen für das Reich, die Länder und auch für die Landeskirchen notwendig.
Kirche wird selbstständig
Fast durch das ganze 19. Jahrhundert hatte man in Württemberg die Schaffung einer Verfassung für die Landeskirche gefordert. Nun war die Herauslösung der evangelischen Kirche aus dem Staatsorganismus und ihre Verselbständigung notwendig geworden. Die Wahl zur Verfassunggebenden Landeskirchenversammlung fand am 1. Juni 1919 statt; sie trat am 14. Oktober 1919 zusammen. Der hier vorgelegte Entwurf einer Kirchenverfassung sah als oberste Organe der Landeskirche eine Landessynode vor, ferner einen Oberkirchenrat als oberste Verwaltungsbehörde. Darüber war rasch Einigung erzielt.

Bischof oder Kirchenpräsident?
Diskussionsbedarf gab es jedoch in der Frage der Leitung der Landeskirche und ihrer Vertretung nach außen. Der Gedanke, einen Bischof, also einen Geistlichen an die Spitze der Landeskirche zu stellen, fand schon früh allgemeinen Anklang. Im Entwurf einer Kirchenverfassung war aber vom Kirchenpräsidenten die Rede, weil man sich nicht ausschließlich auf einen Geistlichen festlegen wollte. Der Kirchenpräsident sollte den Vorsitz im Oberkirchenrat haben, über wichtige Personalfragen sollte er in einem dreiköpfigen Landeskirchenausschuß befinden. Der Kirchenpräsident sollte auf Lebenszeit gewählt werden. Erst ab 1933 gibt es einen württembergischen Landesbischof; erster Amtsträger war Theophil Wurm, der 1929 noch zum Kirchenpräsidenten gewählt worden war.
Erheblicher Gesprächsbedarf bestand in der Verfassungsgebenden Landeskirchenversammlung jedoch in der Frage, ob die Verfassung die Bindung an ein bestimmtes Bekenntnis festschreiben sollte. Die Frage wurde schließlich an einen Ausschuss verwiesen, der einen Kompromiss fand. Im übrigen legte man fest, dass das Bekenntnis kein Gegenstand der kirchlichen Gesetzgebung sei.

Anlass zu Diskussionen gab es bei der der Frage der Urwahl, durch die die Landeskirchenversammlung zustande gekommen war. Man beschloss, diese auch künftig beizubehalten, ebenso wie das Frauenwahlrecht.
Die Umsetzung
Die Verfassung konnte aber erst dann Gültigkeit erhalten, nachdem seitens des Staates das Gesetz über die Kirchen vom 3. März 1924 beschlossen war. Dieses trat zum 1. April 1924 in Kraft. Damit war die Trennung von Kirche und Staat, in der Weise wie es die Weimarer Reichsverfassung von 1919 vorsah, für Württemberg offiziell erfolgt.
Hermann Ehmer