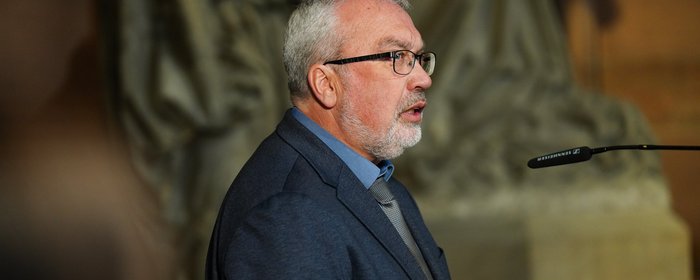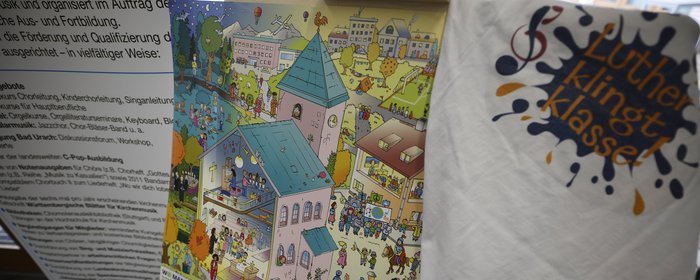Vom 27. bis 29. März 2025 kam die Württembergische Evangelische Landessynode zu ihrer Frühjahrstagung im Stuttgarter Hospitalhof zusammen. Hier finden Sie die Berichterstattung sowie alle Dokumente.
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Landessynode kompakt - Die Hauptthemen der Frühjahrstagung 2025 der Landessynode:
An den beiden Sitzungstagen standen neben einer Reihe von kirchlichen Gesetzen und Sparmaßnahmen der Schwerpunkthalbtag zur Kirchenmusik, Themen rund ums Ehrenamt und mehr auf der Tagesordnung. Synodalpräsidentin Sabine Foth gibt im Video “5 Themen - 5 Antworten” Einblicke zu den Schwerpunktthemen der Frühjahrstagung der Landessynode 2025.
„Zäsur im Finanzverhalten der Landeskirche“: Oberkirchenrat legt umfassendes Sparpaket vor – Ziel sind Einsparungen in Höhe von 103,9 Millionen Euro pro Jahr
Aufgrund rückläufiger Einnahmen und zugleich steigender Versorgungsaufwendungen muss die Landeskirche in den kommenden Jahren massiv sparen. Der Oberkirchenrat hat dazu am ersten Tag der Frühjahrssynode einen detaillierten Vorschlag, die sogenannte Priorisierungsliste, vorgelegt, mit dem die jährlichen Kosten im Haushalt der Landeskirche im engeren Sinne, das sind die zentralen Dienste, Werke und Einrichtungen sowie der Oberkirchenrat, um rund 100 Millionen Euro reduziert werden sollen. Nach der Einbringung der Sparpläne durch den Oberkirchenrat, der synodalen Aussprache und einigen dazu gestellten Anträgen aus der Landessynode werden diese in den kommenden Monaten in den Fachausschüssen beraten. Die Landessynode wird voraussichtlich im Sommer über die Maßnahmen und im Herbst über den Nachtragshaushalt und damit über das Inkrafttreten entscheiden.
Patenamt wird für Christinnen und Christen anderer Konfessionen geöffnet
Die Landessynode hat eine Änderung der Taufordnung beschlossen, die mehr ökumenische Offenheit ermöglicht: Künftig können auch beide Taufpaten einer anderen christlichen Konfession angehören, die Mitglied der ACK ist. Bisher musste mindestens einer der beiden Paten evangelisch sein. Künftig heißt es in der Taufordnung, einer der Paten solle evangelischer Christ sein. Bislang war dies ein Muss.
Ehrenamt auch in Leitungsfunktionen gestärkt
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete im weiteren Verlauf über den eingebrachten Antrag zur Ehrenamtskirche. Dieser habe zum Ziel, bis zu zehn kleinen Kirchengemeinden im Rahmen einer Erprobung die Leitung und Geschäftsführung ohne geschäftsführende Pfarrperson zu ermöglichen.Die Landessynode diskutierte auch die Erarbeitung eines Gesetzentwurfes zur Änderung der Kirchengemeindeordnung durch den Oberkirchenrat, damit der/die 1. und der/die 2. Vorsitz von gewählten bzw. zugewählten Mitgliedern des Kirchengemeinderats wahrgenommen werden können. Beiden Anträgen stimmte die Synode zu und hat damit den Oberkirchenrat gebeten, einen Umsetzungsvorschlag zu machen.
Bilanz von drei Jahren landeskirchlicher Ukraine-Hilfe
Der Vorsitzende der Ukraine-Koordinations-Gruppe, Klaus Rieth, berichtete auf der Frühjahrssynode über die Ukraine-Hilfe der Landeskirche seit März 2022. Dabei bezifferte er die bisherige finanzielle Unterstützung durch die Landeskirche auf 750.000 Euro. Rieth betonte, dass die württembergische Landeskirche die Landeskirche war, die am schnellsten und konkretesten auf die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten reagiert habe. Im Anschluss ging er detailliert auf die Verwendung der finanziellen Mittel ein und forderte zugleich dazu auf, in der Spendenbereitschaft nicht nachzulassen.
Rieth bedankte sich bei der Diakonie Württemberg und dem Gustav-Adolf-Werk (GAW) für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Dabei wies er auf konkrete Spendenmöglichkeiten hin und hob die mehr als 40 Transporte mit Hilfsgütern in die Ukraine hervor. Abschließend dankte er der Synode, dem Oberkirchenrat und ganz besonders den vielen Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden für ihren Einsatz zugunsten der ukrainischen Geflüchteten in Württemberg.
Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
Die URAK ist zuständig für die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt innerhalb der Landeskirche und des Diakonischen Werks Württemberg. Die Kommission soll das Ausmaß sexualisierter Gewalt feststellen, die Strukturen analysieren, die sexualisierte Gewalt ermöglichen oder begünstigen, Empfehlungen zur Prävention und Aufarbeitung geben und das geschehene Unrecht und die oft lebenslangen Folgen für Betroffene anerkennen. Zentrales Element der Aufarbeitungskommission ist die Partizipation. Die Aufarbeitung soll sich konsequent an den Interessen der Betroffenen orientieren. Die URAK setzt sich aus sieben Kommissionsmitgliedern zusammen, die eine unabhängige Arbeitsweise garantieren sollen.
Ralf-Alexander Forkel und Wilhelm Kazmaier sind kommissarische Vertreter der betroffenen Personen aus Kirche und Diakonie. Die Benennung der Betroffenenvertretung und die finale Festlegung der Betroffenenvertretung wird bis Sommer erfolgen.
Als externe Expertinnen und Experten durch das Staatsministerium Baden-Württemberg wurden benannt: Irmgard Fischer-Orthwein. Fischer-Orthwein, sie hat die „Anlauf- und Beratungsstelle Heimerziehung Baden-Württemberg“ aufgebaut und hat von 2012 bis 2018 geleitet. Dr. Dr. Andreas Kruse ist emeritierter Professor am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg und früheres Mitglied des Ethikrats. Prof. Dr. Jörg Kinzig ist Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen.
Für die Landeskirche ist die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz und für das Diakonische Werk ist Prof. Dr. Jürgen Armbruster, ehemaliges Vorstandsmitglied der Evangelischen Gesellschaft und früherer Geschäftsführer des Rudolf-Sophien-Stifts, in die Kommission entsendet worden.
Die URAK wird durch eine Geschäftsstelle mit Geschäftsführerin Katharina Binder unterstützt. Binder war als Sozialplanerin beim Landkreis Ludwigsburg und davor in einer Beratungsstelle für Frauen nach sexualisierter Gewalterfahrung tätig.
Synodalpräsidentin Sabine Foth dankte den Mitgliedern der Kommission im Namen der Landessynode, „dass Sie sich zu dieser verantwortungsvollen und äußerst wichtigen Aufgabe haben berufen lassen“. Die Fortsetzung der umfassenden Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sei „eine Verpflichtung einerseits, aber vor allem sollte es für uns alle ein großes Anliegen sein.“
Schwerpunkthalbtag: Kirchenmusik als „Teil der DNA evangelischer Christinnen und Christen“
Am Vormittag des zweiten Sitzungstages befassten sich die Synodalen in Vorträgen und vielen praktischen Demonstrationen mit der Lage und den Potenzialen der Kirchenmusik in der Landeskirche. Prof. Dr. Dr. Günter Thomas von der Ruhr Universität Bochum betonte in einem Impulsreferat, im gemeinsamen Singen verwische die Grenze zwischen Aktivität und Passivität, Selbstbestimmung und Bestimmt-Werden, zwischen Rationalität und Gefühl: „Im Singen entschließen wir uns, uns entführen zu lassen. (...) Das für eine begrenzte Zeit geliehene Wort, die mit der Musik befristet angeeignete Stimmung erlauben, Glauben und Gottesrede auszuprobieren. (…) Man kann ausprobieren, wie sich dies anfühlt.“ Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider, Leiter des theologischen Dezernats der Landeskirche, erinnerte daran, dass die musikalische Bildung bei den Menschen zurückgehe. Die religiöse und musikalische Musikalität müsse ausgebildet werden: „Das ist eine immense Bildungsaufgabe. Wer soll die leisten? Wer kann sie leisten?“ Kirche müsse darüber nachdenken, wie Gemeinden und Gruppen unterstützt werden können und welche Arten von Haupt-, Neben- und Ehrenamt es brauche. Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke sagte, Musik sei „ein Teil der DNA evangelischer Christinnen und Christen.“ Hierin liege „eine große Chance der Kirchenmusik für unsere Landeskirche: Menschen mit Gottes Nähe zu beglücken.“ Reichweite gelinge der Kirchenmusik durch „durch eine Vielzahl von Begabten: Ehrenamtliche, Neben- und Hauptberufliche. Sie sind der Schatz, ‚das Kapital‘ dieser Kirche“.
Kirchliche Trauung: Gesetzesentwurf zur Trauung gleichgeschlechtlicher Paare eingebracht
Die Landessynode befasste sich am Samstagnachmittag mit einer Reform der kirchlichen Trauung. Gleichgeschlechtliche Paare sollen gemäß dem vom Oberkirchenrat eingebrachten Vorschlag künftig in allen Gemeinden getraut werden können, sofern keine örtliche Regelung dagegensteht. Die Bestimmungen zur Trauung von zwei Personen gleichen Geschlechts finden somit auch dann Anwendung, wenn bei einer bürgerlichen Eheschließung ein Ehegatte oder beide Ehegatten weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht angehören. Umfasst wird damit auch eine nichtbinäre Geschlechtsidentität. Ebenso soll eine einheitliche Agende eingeführt werden, das Gewissensschutzrecht soll bestehen bleiben. Die Entwürfe werden in den Fachausschüssen weiter beraten. Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch, Leiter des Rechtsdezernats, berichtete, dass mit dem neuen Gesetzentwurf zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung eine Entwicklung fortgesetzt werden solle, die bereits 2019 mit der Einführung gottesdienstlicher Formen für gleichgeschlechtliche Paare begonnen habe. Dabei werde, so Frisch, die bisherige Unterscheidung zwischen „kirchlicher Trauung“ und „Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung“ aufgehoben. Alle Eheschließungen würden liturgisch als kirchliche Trauung behandelt. Die Trauagende solle damit landeskirchlich einheitlich geregelt werden; die Begrenzung auf ein Viertel der Gemeinden und die Revisionsklausel sollen entfallen. Ein neues Opt-out-Verfahren solle nach diesem Entwurf das bisherige Opt-in-Verfahren ersetzen: Gemeinden, die keine gleichgeschlechtlichen Trauungen durchführen möchten, müssten dies aktiv in ihrer Gottesdienstordnung festlegen. Damit solle der Kritik am bisherigen Verfahren begegnet werden. Wichtig bleibt der Schutz der Gewissensfreiheit: Niemand sei nach diesem Entwurf verpflichtet, eine solche Trauung zu leiten oder daran mitzuwirken. Neu hinzu kommen solle ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot. Der Entwurf versteht sich laut Dr. Michael Frisch als evolutionäre Weiterentwicklung – mit dem Ziel, Differenz zu respektieren und zugleich die Einheit der Kirche zu wahren.
Beschlüsse der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in ihrer Frühjahrstagung vom 27. bis 29. März 2025
Beschlussübersicht - hier klicken, um alle Beschlüsse zu sehen
Beschlüsse der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in ihrer Herbsttagung vom 27. bis 30. November 2024
Angenommene Anträge
TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Antrag Nr. 05/26)
Die Landessynode hat den vom Oberkirchenrat für die Finanzplanung der nächsten fünf Jahre vorgelegten Eckwerten mehrheitlich zugestimmt.
TOP 09 Kirche in der Arbeitswelt (Antrag Nr. 03/25):
Der Ausschuss für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung hat diesen Antrag eingebracht. In diesem wird der Oberkirchenrat gebeten, das Konzept zum Zusammen-schluss der jeweiligen Kirchlichen Dienste in der Arbeitswelt (KDA) der Ev. Landeskirchen in Baden und in Württemberg zu überarbeiten.
Der Antrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen.
TOP 12 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus (Antrag Nr. 09/25):
Dieser Antrag aus dem Rechtsausschuss zielt auf eine Änderung der Handreichung für Pfarrpersonen, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung von § 2 der Kirchlichen Wahlordnung. In der in Beilage 128 veröffentlichten Fassung werden Verhaltensweisen konkretisiert, die zu einem Ausschluss von der Kirchenwahl führen können.
Die Landessynode hat nach einem Geschäftsordnungsantrag mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen, den Folgeantrag Nr. 09/25 auf Änderung der Handreichung für Pfarrer, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung von § 2 der Kirchlichen Wahlordnung zurück an den Rechtsausschuss unter Beteiligung des Theologischen Ausschusses zu verweisen.
TOP 13 Folgeantrag Ehrenamtliche feiern Andacht (Antrag Nr. 02/25):
Mit diesem Antrag aus dem Theologischen Ausschuss wird der Oberkirchenrat gebeten, die zwischenzeitlich eingestellte Ausbildung für ehrenamtlich Leitende von gottesdienstähnlichen Feiern (Andachten) „EfA“ wieder aufzunehmen.
Der Folgeantrag Nr. 02/25 auf Fortführung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“ wurde mit Mehrheit bei drei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen angenommen.
TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030 (Antrag 15/23)
Der Antrag hat zum Ziel, bis zu 10 kleinen Kirchengemeinden im Rahmen einer Erprobung die Leitung und Geschäftsführung ohne geschäftsführende Pfarrperson zu ermöglichen.
Die Landessynode hat mit Mehrheit beschlossen, den Oberkirchenrat zu bitten, Antrag 15/23 umzusetzen.
TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzenden von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder (Antrag Nr. 26/23)
Dieser Antrag regt eine Gesetzesänderung der Kirchengemeindeordnung (KGO) an, die ermöglichen soll, dass beide Vorsitzende einer Kirchengemeinde gewählte Mitglieder im Kirchengemeinderat sein können. Bislang ist einer der beiden Vorsitzenden zwingend die geschäftsführende Pfarrperson der Kirchengemeinde.
Der Antrag 26/23 wurde mit großer Mehrheit angenommen.
Beschlossene Gesetzesentwürfe
TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes (Beilage 124)
Dieser Gesetzesentwurf des Rechtsausschusses regelt insbesondere die Vorlage- und Auskunfts-pflicht zu prüfender Stellen auch hinsichtlich digital vorliegender Daten neu.
Das Gesetz wurde in erster und zweiter Lesung einstimmig beschlossen.
TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Taufordnung (Beilage 123)
Mit diesem Gesetzesentwurf des Rechtsausschusses soll geändert werden, dass zukünftig Taufpaten keine Mitglieder einer evangelischen Landeskirche mehr sein müssen. Dies wird durch eine Soll-Bestimmung ersetzt.
Das Gesetz wurde in erster und zweiter Lesung beschlossen.
TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (Beilage 115)
Durch die vom Oberkirchenrat vorgelegte Gesetzesänderung soll mit einer Anpassung der Stellvertretungsregelung die Beschlussfähigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission besser sichergestellt werden.
In erster und zweiter Lesung beschlossen.
TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetzes (Beilage 129)
Dieser Gesetzesentwurf soll dazu beitragen, Versorgungslasten für Pfarrpersonen und Kirchen-beamte zu verringern, ohne grundlegend in den Anspruch auf Versorgung als Alimentationsleistung einzugreifen.
In erster und zweiter Lesung beschlossen.
Verwiesene Gesetzesentwürfe
TOP 05 Kirchliche Gesetze über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
Mit diesem Gesetzesentwürfen soll die formale Grundlage für den Zusammenschluss der Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd zum 1. Januar 2026 geschaffen werden.
Der Gesetzesentwurf wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.
TOP 10 Ergänzung zum Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil: Sakramente und Amtshandlungen, Teilband Die kirchliche Trauung 2020 (Antrag Nr. 11/25) Der Antrag Nr. 11/25 des Oberkirchenrats schlägt eine Ergänzung des Württemberger Gottesdienst-buchs für die kirchliche Trauung um eine Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ vor. Diese Änderung wurde an den Theologischen Ausschuss verwiesen.
TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 130)
Mir der zugehörigen Gesetzesinitiative (Beilage 130) schlägt der Oberkirchenrat eine entsprechende Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen zum Traurecht vor.
Der Gesetzesentwurf wurde an den Rechtsausschuss unter Beteiligung des Theologischen Ausschuss verwiesen.
TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
Mit diesem Gesetzesentwurf soll die für synodale Arbeit beantragbare Entschädigung für Verdienst-ausfall auf maximal 250 € pro Tag begrenzt werden.
Der Gesetzesentwurf wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.
Verwiesene Anträge
TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Anträge Nr. 10, 12-19/25):
Die Anträge 12 - 19/25 wurden im Rahmen der Debatte zur Haushaltskonsolidierung eingebracht.
Die Anträge 10, 12 - 19/25 wurden an den Sonderausschuss für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte unter Beteiligung des Finanzausschusses verwiesen.
TOP 10 Ergänzung zum Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil: Sakramente und Amtshandlungen, Teilband Die kirchliche Trauung 2020 (Antrag Nr. 11/25)
(siehe unter „Verwiesene Gesetzesentwürfe“, TOP 10)
TOP 26 Selbstständiger Antrag: Beschleunigung und Vereinfachung bei Neuanstellungen von kirchlichen Mitarbeitenden (Antrag Nr. 01/25):
Dieser Antrag fordert, dass bei Neuanstellungen die Klärung der Anstellung und die Beteiligung der Mitarbeitervertretung beschleunigt wird.
Der Antrag wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.
TOP 26 Selbstständiger Antrag: Änderung Förderpraxis Ausgleichsstock PV-Anlagen und Batteriespeicher (Antrag Nr. 04/25):
In diesem Antrag wird der OKR gebeten, die Förderpraxis des Ausgleichsstocks insofern zu ändern, dass eine Förderung bei Pfarrhäusern auch dann möglich ist, wenn die Anlage an den Stellen-inhaber verpachtet ist oder der erzeugte Strom an diesen verkauft wird.
Der Antrag wurde an den Finanzausschuss verwiesen.
TOP 26 Selbstständiger Antrag: Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog (Antrag Nr. 06/25):
Mit diesem Antrag soll erreicht werden, dass in jedem Kirchenbezirk eine Ansprechperson für den interreligiösen Dialog unter Jugendlichen benannt wird. Diese soll Jugendliche zum Dialog zusammenbringen und im Gespräch begleiten.
Der Antrag wurde an den Ausschuss für Bildung und Jugend verwiesen.
TOP 26 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikations-kanäle des OKR (Antrag Nr. 07/25):
In diesem Selbstständigen Antrag wird der Oberkirchenrat aufgefordert, bis zum Beginn der neuen KGR-Wahlperiode die Voraussetzungen für eine direkte Information und Kommunikation des OKR auch mit den gewählten Kirchengemeinderats-Vorsitzenden zu schaffen.
Der Antrag wurde an den Ausschuss für Kirchen- und Gemeindeentwicklung verwiesen.
TOP 26 Aufarbeitung der Coronazeit und Förderung von Versöhnungsprozessen (Antrag Nr. 08/25):
Dieser Antrag zielt auf die Entwicklung eines Konzepts durch den Oberkirchenrat zur Reflektion und Aufarbeitung des Vorgehens und Handelns der Kirchen während der Coronazeit ab.
Der Antrag wurde an den Ausschuss für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung verwiesen.

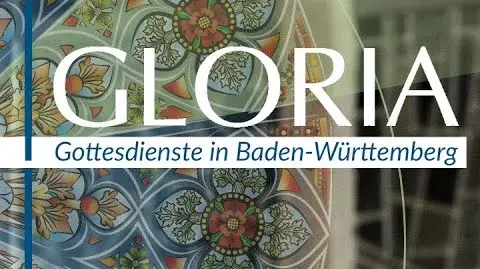




Gottesdienst
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Eröffnungsgottesdienst

In seiner Predigt über Matthäus 26, 69-75 dachte Pfarrer Matthias Vosseler über die Figur des Petrus nach, der in der Stunde der größten Bedrängnis Jesus verleugnete und trotzdem von Jesus nicht aufgegeben wurde. Vosseler betonte, in der Kirche, auch in der württembergischen Landeskirche, stehe jede und jeder in der Nachfolge des Petrus.
Pfarrer Matthias Vosseler stellte den Kontrast heraus zwischen dem Petrus, der zu Beginn der Passionsgeschichte mutig gewesen sei, „Ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod“, sich aber dann am Tiefpunkt mit jeder der drei Verleugnungen weiter von Jesus entfernt und zuletzt - enttäuscht von sich und entsetzt über sich selbst - bitter geweint habe.
Bei Jesus aber werde man nicht abgeschrieben, wenn man einen Fehler gemacht habe, sondern bekomme die Chance eines neuen Anfangs. Vosseler sagte: „Diese Geschichte von Petrus macht mir Mut, mich von Gott immer wieder rufen zu lassen, seine Nähe zu suchen, wenn ich weit von ihm entfernt bin. Sie macht mir Mut, meine Fehler einzugestehen und darüber zu weinen. Sie macht mir Mut, mein Leben bei all seinen krummen Linien in der Gnade Gottes gehalten und geborgen zu wissen.“
Vosseler bezog dies auf alle Gläubigen: „Wir sind alle in der Nachfolge des Petrus: wir sind der Fels, auf den Gott unsere Kirche baut, protestantische Ekklesiologie at its best. Auch wenn dieser Fels des Öfteren zerbröselt, Gott richtet ihn wieder auf. Nicht auf einen Menschen, nicht auf eine Institution, sondern auf uns alle baut Gott seine Kirche und seine Gemeinde. Er baut sie auf die Gruppe von Synodalen, die seit fünf Jahren hier das Beste für unsere Kirche versuchen, die sich aufregen und abregen, die kürzen und streichen müssen, weil wir nicht mehr die finanziellen Mittel haben. Jesus baut seine Kirche, die streitet, die sich irrt und scheitert, alle in dieser Kirche. Er baut diese Kirche, die unglaublich viel Zeit und Energie investiert, wo es humpelt und rumpelt, aber die auf Neues hoffen und es mit entwickeln darf.“
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Grußworte
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Grußwort von Axel Wermke, Präsident der Landesssynode der Evangelischen Landeskirche in Baden

Axel Wermke, Präsident der badischen Landessynode, berichtete in seinem Grußwort von fruchtbaren Gesprächen des badischen mit dem württembergischen Synodalpräsidium, von weiteren Begegnungen der beiden Landeskirchen sowie von der Idee einer gemeinsamen Synodaltagung. Er wies zudem darauf hin, dass die badische Landessynode sich mit ähnlichen Themen befasse wie die württembergische, etwa mit Kirchenbezirksfusionen, Haushaltskonsolidierung und Überlegungen zu Lebensordnungen. In Erinnerung an den „Tag für Engagierte“ in Mannheim betonte Wermke, „dass die Kirche trotz allem noch so viele Möglichkeiten hat, wenn man nach vorne schaut, die Gemeindeglieder mitnimmt und ernst nimmt.“
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Grußwort von Christine Schöps, 2. Vizepräsidentin der Landessynode, Ev. Kirche der Pfalz

Christine Schöps, 2. Vizepräsidentin der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz, betonte in ihrem Grußwort die Verbindungen zwischen der pfälzischen und der württembergischen Landeskirche. Der pfälzischen Landessynode stellen sich im Mai ähnliche Aufgaben. Die Zukunft sei eine Verantwortungsaufgabe. Es gelte, sich auf das Wesentliche des kirchlichen Auftrags zu konzentrieren. In den Gemeinden und in der Synode seien die Zeichen der Zeit erkannt, dass nichts so bleiben werde, wie es ist. Bemerkenswert am Priorisierungsprozess in der pfälzischen Landeskirche sei, wie viele Austauschforen es auf allen kirchlichen Ebenen gebe.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Grußwort von Pfarrerin Ines Fischer, Ev. Gemeinde Deutscher Sprache in Jerusalem

Ines Fischer, württembergische Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Jerusalem, berichtete in ihrem Grußwort, wie sie die Situation in Israel, dem Gazastreifen und der Westbank erlebe. Sie erlebe „trotz eines größtenteils funktionierenden Raketenabwehrschirms die Angst vor einer ultimativen Auslöschung des Staates aufgrund der Angriffe aus dem Libanon, dem Iran und dem Jemen im letzten Jahr als sehr präsent. Die Erfahrung der Schutzlosigkeit am 7. Oktober hat transgenerationale Traumata getriggert. Die unwürdige Zurschaustellung der Geiseln bei ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen und die Sorge um die weiterhin in Gaza Festgehaltenen – all dies treibt die Menschen um.“
Auf der anderen Seite trauere die palästinensische Gesellschaft um rund 50.000 Tote. Der Gazastreifen sei so gut wie vollständig verwüstet. In der Westbank nähmen „Hauszerstörungen durch die Armee und durch radikale Siedler exponentiell zu“. Auch die „Angst der palästinensischen Bevölkerung vor einer endgültigen Auslöschung“ sei im Alltag sehr präsent.
Fischer stellte in ihrem Grußwort Menschen vor, die „über den eigenen Schmerz hinaus auch das Leid der anderen sehen“. Es sei wichtig, „gerade ihrer Stimme Gehör zu verleihen. Denn trotz allem gibt es sie: Diejenigen, die spüren, dass es auf Dauer nur miteinander geht. Aber sie sind wenige und haben auch in ihrer jeweils eigenen Bevölkerung wenig Rückhalt.“
Avi Dabush sei Direktor der Rabbiner für Menschenrechte und repräsentiert Rabbiner und Rabbinerinnen aller jüdischen Konfessionen, die sich vor 35 Jahren in Israel zusammengeschlossen haben, um auf ein Ende der Besatzung hinzuwirken. Obwohl er selbst in Todesangst gewesen sei, habe er „den Frieden und den Glauben an die Gleichheit aller in seinem Herzen bewahrt“.
Im Parents Circle Family Forum treffen sich laut Fischer israelische und palästinensische Familien, die ein Familienmitglied durch Gewalt, Terror oder Krieg verloren haben. Das Ziel der Organisation sei die Suche nach einer gemeinsamen Zukunft. Sie umfasse mittlerweile rund 700 Familien.
Zuletzt stellte Fischer ein palästinensisches Ehepaar aus der Westbank vor. Beide seien seit vielen Jahren in der gewaltfreien Friedensarbeit aktiv. Ihr Haus sei letztes Jahr niedergerissen worden. Mit fünf Kindern seien sie von einem Tag auf den anderen obdachlos gewesen. Obwohl sie unter der Gewalt israelischer Siedler leiden, wüssten sie, „dass nicht alle Israelis Siedler sind und wir sehen, dass es viele gibt, die uns unterstützen und das nicht richtig finden, was hier geschieht”.
Fischer sagte, ihre persönliche Hoffnung sei, „dass diese Stimmen in der Zukunft stärker werden. Denn ich sehe nicht, wie es anders irgendeine Lösung geben könnte”.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Grußwort von Pfarrerin Dr. Kristin Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags

Pfarrerin Dr. Kristin Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, lädt in ihrem Grußwort die Synodalen zum kommenden Kirchentag in Hannover ein. Sie betonte, der Kirchentag verstehe sich seit seiner Gründung 1949 als Diskursplattform und Gesprächsraum über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Er wolle Menschen “mündig machen in der Schrift” und helfen zu erkennen, was man selbst gesellschaftlich tun könne. Der Kirchentag wolle einen Beitrag dazu leisten, dass Demokratie und Zivilgesellschaft erhalten bleiben. Er ziele auf ein Miteinander trotz aller Differenzen und mache den Gedanken stark, dass Gott das letzte Wort habe, und erinnere zugleich an die von Gott geschenkte Freiheit und Mündigkeit des Menschen. Jahn erklärte, es seien für den Kirchentag in Hannover Plattformen für Kontroversen geplant, und es seien alle Menschen eingeladen, unabhängig von ihrer politischen Orientierung.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes (Beilage 124)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 01
Rechnungsprüfamtgesetz: Zugriff auf digitale Daten

Das Rechnungsprüfamt der Landeskirche benötigt zur Erfüllung seiner Aufgabe, der Überprüfung kirchlichen Handelns auf Wirtschaftlichkeit, den Zugriff auf digital gespeicherte Daten. Die Landessynode hat einstimmig das Gesetz beschlossen, das den Zugang sowie weitere Möglichkeiten des Amtes regelt.
Für den Rechtsausschuss umriss dessen Stellvertretender Vorsitzender, Prof. Dr. Martin Plümicke, die Aufgaben des Rechnungsprüfamtes (RPA) der Landeskirche. Diese unabhängige Institution unterstütze kirchliche Organe bei ihrer Finanzverantwortung. Die Kirche sei dafür verantwortlich, die Mittel, die die Mitglieder aufbrächten, sorgsam zu verwalten.
Das RPA brauche zur Erfüllung seiner Aufgaben Informationen von anderen Stellen. Neue Herausforderungen bringe der Zugang zu digitalen Daten mit sich. Dieser sei zu regeln, damit das RPA die gleichen Möglichkeiten wie beim Zugang zu analogen Daten habe.
Prof. Dr. Plümicke wies auf den Antrag in der Sommertagung 2022 hin, der auf eine vollständige und unbeschränkte Vorlage erforderlicher Unterlagen ziele.
Im Gesetzentwurf werde die Vorlagepflicht gegenüber dem RPA bezüglich elektronisch gespeicherter Daten geregelt, sowie u.a. die Möglichkeit des RPA, Hinweise zur Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu geben.
Details der Vorlagepflicht, wie die Aufzählung der umfassten Dokumentarten, solle eine Verordnung des Oberkirchenrats regeln. Dieses Vorgehen begrüße der Rechtsausschuss.
Im Namen des Ausschusses bat Prof. Dr. Martin Plümicke um Zustimmung zum Gesetzentwurf.
Aussprache
In der Aussprache regte der Synodale Gerhard Keitel (Maulbronn) an, im Gesetzentwurf in der Neufassung von § 6 Abs. 1 Satz 4 den Begriff „der Präsidentin” als Ergänzung zu „dem Präsidenten“ zu ergänzen.
Beschluss
Der Gesetzentwurf wurde einstimmig verabschiedet.
Den vollständigen Bericht zu TOP 01 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung (Beilage 123)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Mitglieder aus Kirchen der ACK können das Patenamt auch übernehmen

Die Landessynode beriet über eine Änderung der Taufordnung, die mehr ökumenische Offenheit ermögliche. Künftig müsse nicht mehr zwingend ein evangelischer Christ als Taufpate erforderlich sein. Auch katholische Christen und Mitglieder anderer ACK-Kirchen können das Amt übernehmen. Der Rechtsausschuss empfehle der Synode die Annahme.
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete in der Sitzung der 16. Landessynode am 28. März 2025 über den Antrag zur Änderung der Taufordnung (§10 Abs. 2). Der Antrag sei bereits auf der Frühjahrssynode 2023 eingebracht und zur weiteren Bearbeitung an den Rechtsausschuss sowie unter Beteiligung des Theologischen Ausschusses verwiesen worden.
Plümicke erläuterte, dass der Oberkirchenrat auf Bitte des Rechtsausschusses einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt habe. Künftig solle es in §10 Abs. 2 heißen, dass einer der Paten soll, statt muss evangelischer Christ, um zum Patenamt zugelassen zu sein. Auch Christen aus Kirchen der ACK könnten das Patenamt übernehmen; in begründeten Ausnahmefällen auch Glieder anderer Kirchen.
Diese Änderung, so Plümicke, helfe aus einem bestehenden Dilemma heraus: Bisher seien katholische Christen häufig auf das Taufzeugenamt reduziert worden, wenn kein evangelischer Pate benannt war. Künftig könnten sie als vollwertige Paten fungieren.
Der Rechtsausschuss empfehle einstimmig, die Beilage 123 anzunehmen.
Aussprache
Thorsten Volz (Backnang) bedankte sich bei der Synode für die Aufnahme seines Antrags und für die Zustimmung zur Änderung der Taufordnung.
Beschluss
Der Antrag Nr. 52/22: Änderung der Taufordnung, § 10 Absatz 2 zum Patenamt wurde in 1. Lesung einstimmig angenommen. Auch in zweiter Lesung am zweiten Sitzungstag wurde das Gesetz mit großer Mehrheit angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (Beilage 115)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 03
Durch neue Regelung bleibt Arbeitsrechtliche Kommission bei personellen Engpässen handlungsfähig

Die Landessynode stimmte dem Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (Beilage 115) mit großer Mehrheit zu. Ziel ist eine verlässlichere Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission sowie eine klarere Regelung der Amtszeit ihrer Mitglieder.
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete, der Ausschuss habe am 10. Januar 2025 über den eingebrachten Gesetzentwurf beraten. Ziel der Änderungen sei es, die Arbeitsrechtliche Kommission auch bei personellen Engpässen vollständig besetzen zu können. Dazu solle künftig ein zusätzliches Mitglied aus der jeweiligen Liste einspringen dürfen, wenn weder Haupt- noch Stellvertretung verfügbar seien – auf allen vier Bänken.
Zudem solle die Amtszeit der Mitglieder der Kommission an die Amtszeit der Landessynode gekoppelt werden, um Klarheit und Kontinuität zu gewährleisten.
Die LakiMAV und das Diakonische Werk hätten die Änderungen begrüßt. Die AGMAV habe einen weitergehenden Vorschlag eingebracht, der den Verzicht auf ACK-Mitgliedschaft fordere.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch habe betont, der Oberkirchenrat sehe aktuell keinen Handlungsbedarf. Die Kommission sei neu berufen worden und funktioniere. Zudem unterscheide sie sich von der MAV durch ihre delegierte Rechtsetzungskompetenz.
Der Rechtsausschuss empfahl mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung die Annahme des Gesetzentwurfs.
Aussprache
In der Aussprache gab es keine Wortmeldungen.
Beschluss
Das Kirchliche Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetztes (Beilage 115) wurde ohne Aussprache in 1. und in 2. Lesung mit großer Mehrheit angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 03 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Pfarrerversorgungsgesetz, Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetz wird angepasst

Der Rechtsausschuss brachte einen Gesetzentwurf zur Änderung des Pfarrerversorgungs- sowie des Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetzes (Beilage 129) in die Synode ein. Nach Beratung und Erläuterung wurde die Gesetzesänderung von der Landessynode beschlossen.
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, brachte in der Sitzung der 16. Landessynode am 28. März 2025 die Beilage 129 ein. Er betonte, dass nicht der Rechtsausschuss selbst Änderungen an der ursprünglichen Beilage 107 vorgenommen habe, sondern dass der Oberkirchenrat entsprechende Vorschläge eingebracht habe.
Plümicke erläuterte, dass der Gesetzentwurf u. a. Anpassungen im Ruhegehaltsrecht enthalte. So solle die bisherige doppelte Anrechnung von Auslandstätigkeiten entfallen, da die ursprünglichen gesundheitlichen Risiken durch medizinischen Fortschritt und geänderte Lebensbedingungen heute weniger relevant seien. Eine Übergangsregelung solle bestehende Ansprüche sichern.
Zudem werde vorgeschlagen, die Sterbegeldregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer an die Regelungen für Kirchenbeamtinnen und –beamten des Landes anzugleichen, um Einheitlichkeit und Einsparungen zu erzielen. Auch solle künftig die Gewährträgerschaft der Landeskirche als Zuschuss gelten, um Einkünfte aus Tätigkeiten bei diakonischen Trägern einfacher anrechnen zu können.
Ein neuer § 21 Abs. 2 sehe Unterhaltsbeiträge als Alternative zur Nachversicherung vor, um hohe Einmalzahlungen zu vermeiden. Auch Rentenansprüche aus anderen Landeskirchen sollen bei geleisteten Beiträgen berücksichtigt werden. Der Rechtsausschuss empfahl die Annahme der Beilage.
Aussprache
In der Aussprache gab es keine Wortmeldungen.
Beschluss
Das Kirchliche Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129) wurde ohne Aussprache in 1. und 2. Lesung mit großer Mehrheit angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 04 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 05
Landessynode 53 KB TOP 05 - Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126) (PDF)
Landessynode 25 KB TOP 05 - Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126) (Anhörung) (PDF)
Landessynode 50 KB
Geplanter Zusammenschluss Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd: Gesetzentwurf

Zum 1. Januar 2026 sollen die Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd den Ev. Kirchenbezirk Ostalb am Standort Aalen bilden, indem der Kirchenbezirk Aalen erweitert und der Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd aufgehoben werde. Die Landessynode hat das entsprechende Gesetz an den Rechtsausschuss verwiesen.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtete für den Oberkirchenrat, dass die Strukturen der Landeskirche auf allen Ebenen an die gesunkenen Gemeindegliederzahlen angepasst werden müssten. Für die Evangelischen Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd seien gemäß dem vorgelegten Gesetzentwurf folgende Änderungen geplant: Der Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd werde aufgehoben, der Kirchenbezirk Aalen vergrößert und sein Name in „Kirchenbezirk Ostalb“ geändert. Das Vorgehen sei laut Oberkirchenrat Dr. Frisch mit den Betroffenen abgestimmt.
Die Neubildung einer Mitarbeitervertretung sei nicht erforderlich, da kein neuer Kirchenbezirk gebildet werde. Im Gesetzentwurf sehe eine Übergangsbestimmung vor, dass die Mitarbeitervertretungen der Kirchenbezirke Schwäbisch Gmünd und Aalen vorübergehend gemeinsam die Mitarbeitervertretung bildeten.
Oberkirchenrat Dr. Frisch regte die Verweisung an den Rechtsausschuss an.
Es gab keine Wortmeldungen.
Der Gesetzentwurf wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 05 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Begrüßung der Mitgleider der URAK
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg

Die Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg wurden während der Frühjahrstagung der Landessynode begrüßt. Die URAK ist zuständig für die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt innerhalb der Landeskirche und dem Diakonischen Werk Württemberg.
Die Kommission soll das Ausmaß sexualisierter Gewalt feststellen, die Strukturen analysieren, die sexualisierte Gewalt ermöglichen oder begünstigen, Empfehlungen zur Prävention und Aufarbeitung geben und das geschehene Unrecht und die oft lebenslangen Folgen für Betroffene anerkennen. Zentrales Element der Aufarbeitungskommission ist die Partizipation. Die Aufarbeitung soll sich konsequent an den Interessen der Betroffenen orientieren.
Die URAK setzt sich aus sieben Kommissionsmitgliedern zusammen, die eine unabhängige Arbeitsweise garantieren sollen:
Ralf-Alexander Forkel und Wilhelm Kazmaier sind kommissarische Vertreter der betroffenen Personen aus Kirche und Diakonie. Die Benennung der Betroffenenvertretung und die finale Festlegung der Betroffenenvertretung wird bis Sommer erfolgen.
Als externe Expertinnen und Experten durch das Staatsministerium Baden-Württemberg wurden benannt: Irmgard Fischer-Orthwein. Fischer-Orthwein, sie hat die „Anlauf- und Beratungsstelle Heimerziehung Baden-Württemberg“ aufgebaut und hat von 2012 bis 2018 geleitet. Dr. Dr. Andreas Kruse ist emeritierter Professor am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg und früheres Mitglied des Ethikrats. Prof. Dr. Jörg Kinzig ist Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen.
Für die Landeskirche ist die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz und für das Diakonische Werk ist Prof. Dr. Jürgen Armbruster, ehemaliges Vorstandsmitglied der Evangelischen Gesellschaft und früherer Geschäftsführer des Rudolf-Sophien-Stifts, in die Kommission entsendet worden.
Die URAK wird durch eine Geschäftsstelle mit Geschäftsführerin Katharina Binder unterstützt. Binder war als Sozialplanerin beim Landkreis Ludwigsburg und davor in einer Beratungsstelle für Frauen nach sexualisierter Gewalterfahrung tätig.
Synodalpräsidentin Sabine Foth dankte den Mitgliedern der Kommission im Namen der Landessynode, „dass Sie sich zu dieser verantwortungsvollen und äußerst wichtigen Aufgabe haben berufen lassen“. Die Fortsetzung der umfassenden Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sei „eine Verpflichtung einerseits, aber vor allem sollte es für uns alle ein großes Anliegen sein.“
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts und zur Themenübersicht
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 06
Landessynode 1 MB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 64 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Textteil) (PDF)
Landessynode 256 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Zahlenteil) (PDF)
Landessynode 95 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des OKR - OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (Beilage 131) (PDF)
Landessynode 830 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Antrag Nr. 05-25 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029) (PDF)
Landessynode 51 KB


Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 06
Landessynode 1 MB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 64 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Textteil) (PDF)
Landessynode 256 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Zahlenteil) (PDF)
Landessynode 95 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des OKR - OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (Beilage 131) (PDF)
Landessynode 830 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Antrag Nr. 05-25 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029) (PDF)
Landessynode 51 KB
Bericht des Oberkirchenrats

Finanzdezernent Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters legte die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029 vor. Mit dieser seien die beschlossene Versorgungsdeckungsstrategie sowie die Einsparungen der Priorisierungsliste berücksichtigt worden. Mit den Eckwerten würde ein solider Finanzrahmen vorliegen.
Kirchensteuereinnahmen gehen real stark zurück: Trotz nominal leicht steigender Kirchensteuereinnahmen in den kommenden Jahren durch inflationsbedingt steigende Löhne und Gehälter würden diese beinahe ganz durch Kirchenaustritte kompensiert. 2025 sei von einem Kirchensteueraufkommen von 780 Mio. Euro auszugehen.
Zwei Drittel der Aufwendungen entfallen auf Personal: Insgesamt würden 2025 ordentliche Erträge von etwa 727 Mio. Euro erzielt, diese würden bis 2029 steigen. Die Personalaufwendungen für laufende Gehälter, Besoldung und Versorgung entsprächen etwa dem Kirchensteueraufkommen.
Konsequente Umsetzung aller Einsparvorgaben dringend geboten: Bereits ab 2026 werde sich die Umsetzung der Vorgaben aus der Priorisierungsliste bemerkbar machen und im Jahr 2028 die volle Wirkung entfalten.
Größte Herausforderung bleibt die Versorgungsdeckungslücke: Geplant sei, die Deckungslücke der Altersvorsorgesysteme bis 2036 zu schließen. Die jährliche Erhöhung dazu betrage ca. 80 Mio. Euro. Durch höhere Aufwendungen seien die Mittel bis 2027 nur für die unterjährig neu entstandenen Verpflichtungen gebunden.
Aufgabenbereich der Kirchengemeinden und Rücklagenentwicklung: 2025 sinke die Gesamtzuweisung an Gemeinden und Bezirke gegenüber 2024. Trotz nominaler Steigerungen bis 2029 werde es vor Ort zu Herausforderungen kommen, da Sachkosten, Energiekosten und Personalkosten deutlich ansteigen würden. Bis 2026 stünden Entnahmen aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage an.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 06
Landessynode 1 MB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 64 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Textteil) (PDF)
Landessynode 256 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Zahlenteil) (PDF)
Landessynode 95 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des OKR - OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (Beilage 131) (PDF)
Landessynode 830 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Antrag Nr. 05-25 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029) (PDF)
Landessynode 51 KB
Bericht des Finanzausschusses

Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses, führte aus, dass der prognostizierten Zahl der Eckwerteplanung für 2025 der Kirchensteuereinnahmen mit 780 Mio. Euro eine gewisse Vorsicht zugrunde liege. Die wirtschaftliche Lage sei volatil und die Austrittszahlen unverändert hoch. Der Finanzausschuss halte sie unter den beschriebenen Rahmenbedingungen für realistisch. Das Absenken der Kirchensteuerprognose erhöhe allerdings die Dringlichkeit der Sparbemühungen. Die Fehlbeträge der kommenden drei Jahre müssten erneut der Ergebnisrücklage entnommen werden. Ziel sei es, bis 2028 wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.
Geiger fragte angesichts der Austrittszahlen weiter, wie es gelingen könne, dass Kirche die Verbindung zu unseren Mitgliedern stärke. Es gebe keine schnellen Antworten und Programme, aber die Frage müsse erlaubt sein, „ob wir alles tun, was möglich wäre”. Die dringenden und notwendigen Struktur- und Organisationsfragen würden die tatsächlichen Zukunftsfragen nicht beantworten.
Der ordentliche Verteilbetrag für Kirchengemeinden solle in den kommenden Jahren jeweils um 0,6 Prozent erhöht werden. Das entspräche nicht den Kostensteigerungen durch höhere Löhne und Gehälter, die mit 3 Prozent veranschlagt würden. Auch die Kirchengemeinden und -bezirke müssten Einsparungen vornehmen. Die Höhe der Vorwegabzüge sei kritisch zu markieren.
Der Finanzausschuss der Landessynode empfehle die Beschlussfassung der Eckwerteplanung.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 06
Landessynode 1 MB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 64 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Textteil) (PDF)
Landessynode 256 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Zahlenteil) (PDF)
Landessynode 95 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Bericht des OKR - OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (Beilage 131) (PDF)
Landessynode 830 KB TOP 06 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029 (Antrag Nr. 05-25 - Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029) (PDF)
Landessynode 51 KB
Aussprache und Beschluss

Aussprache
Der Synodale Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) sei dankbar, dass der Anteil an die Kirchengemeinden und Kirchenbezirke in der Eckwerteplanung etwa stabil gehalten werden könne. Trotz Verringerung des Gesamtvolumens und der damit verbundenen Möglichkeiten in den Gemeinden sei es wenigstens keine Minuskurve geworden. Diese Stabilität sei wertvoll und verantwortlich. Durch viele langfristige finanziellen Verpflichtungen – vor allem beim Personal – sei die Kirche sehr gebunden. Schultz-Berg äußerte aber den Wunsch, den Kirchengemeinden zu erlauben, ihre Rücklagen in Anspruch zu nehmen. Die 780 Mio. Kirchensteuerannahmen für 2025 vorsichtig zu prognostizieren, sei richtig. Er empfahl die Zustimmung der „umsichtigen“ Eckwerteplanung 2025 bis 2029.
Beschluss
In der Abstimmung wurde die Eckwerteplanung 2025-2029 von den Landessynodalen mehrheitlich angenommen.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB


Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Aufgrund rückläufiger Einnahmen und zugleich steigender Versorgungsaufwendungen muss die Landeskirche in den kommenden Jahren massiv sparen. Der Oberkirchenrat hat dazu in der Synodaltagung einen detaillierten Vorschlag vorgelegt, mit dem die jährlichen Kosten im Haushalt der Landeskirche im engeren Sinne, das sind die zentralen Dienste, Werke und Einrichtungen sowie der Oberkirchenrat, um rund 100 Millionen Euro reduziert werden sollen.
Bericht des Oberkirchenrats – Direktor Stefan Werner

Stefan Werner, Direktor im Oberkirchenrat, bezeichnete in seinem Bericht den vorgelegten Entwurf als „Zäsur im Finanzverhalten der Landeskirche und den daraus abzuleitenden Strategien.“ Die Kirche sei gezwungen, sich zu fokussieren: „Das heißt im Klartext, wir werden kleiner, wir haben weniger Stellen, weniger Sachmittel, weniger Immobilien, weniger Ausbildungsplätze, weniger Servicestellen in der Verwaltung usw. Sind wir damit eine kaputtgesparte Kirche? Ganz sicher nicht.“
Oberkirchenrat und Landessynode hätten diesen Prozess aus eigener Kraft gestalten können und der Oberkirchenrat könne „im Ergebnis ein ambitioniertes Einsparpaket vorlegen, dass unserer Landeskirche hoffentlich auch in Zukunft die Handlungsfähigkeit erhält und uns vor drastischen Kürzungsschritten, bspw. ruckartigen Schließungen von Arbeitsfeldern oder betriebsbedingten Kündigungen, bewahrt. Letzteres ist deutlich herauszuheben.“
Werner hob hervor, es seien „Prioritäten gesetzt und doch auch gleichmäßig in den Arbeitsfeldern Konsolidierungsbeiträge erarbeitet“ worden. Man habe dabei auf eine aufwändige „Entwicklung eines fokussierten Kirchenbildes mit hochtrabendem Titel verzichtet.“ Zu unterschiedlich seien die „verschiedenen Kirchenbilder, die uns und die Kirchenmitglieder prägen “. Ein einheitliches Kirchenbild hätte bedeutet, „dass sich ein bestimmtes Kirchenbild gegen andere Kirchenbilder durchsetzt. Das wollten wir aufgrund der Pluralität und Vielschichtigkeit unserer Landeskirche nicht“. So lege das Kollegium des Oberkirchenrats einen „ausgewogenen, im Kollegium gemeinsam diskutierten und mitgetragenen Vorschlag vor, in dem sich kein Aufgabenfeld zulasten anderer Aufgabenfelder durchsetzt, nicht bespart wird oder gar ausgebaut wird.“
Weiter berichtete Werner, es habe in den Ausschussberatungen den Vorschlag gegeben, Kürzungen im Bereich der Jugendarbeit zu reduzieren und dies durch die Aufgabe aller Tagungshäuser zu kompensieren. Dem habe das Kollegium aber nicht zustimmen können, da man sonst „unsere Zusage, keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen zu müssen, hätte aufgeben müssen“.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Bericht des Oberkirchenrats – Dr. Fabian Peters

Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters, Finanzdezernent der Landeskirche, legte dar, es müssten im Haushalt 103,9 Millionen Euro eingespart werden. Davon entfielen 41,7 Mio. Euro auf befristete, auslaufende Planansätze sowie auf die 155 Planstellen in der Verwaltung, die kw-Vermerke (= künftig wegfallend) erhalten hätten und in den kommenden Jahren entfielen. Für die weiter einzusparenden 62,2 Millionen Euro schlage der Oberkirchenrat vor, ab dem Jahr 2028 jährlich 58,5 Mio. Euro des laufenden Aufwands zu reduzieren. Die dann noch fehlenden 3,4 Mio. Euro könnten im Bereich der Evangelischen Regionalverwaltungen erst nach 2030 umgesetzt werden. Peters wies darauf hin, dass die meisten Reduzierungen erst zeitversetzt zum Beispiel ab 2028 greifen.
Die genannten 58,5 Mio. Euro verteilen sich laut Peters folgendermaßen:
- 19,8 Mio. Euro durch Reduzierung von Sachmitteln
- 15,4 Mio. Euro betreffen Zuweisungen an Dritte
- 14,9 Mio. Euro wegfallende Haushaltsreste
- 8,3 Mio. Euro Streichung landeskirchlicher Personalstellen
Direktor Stefan Werner ergänzte in Bemerkungen zum Prozess, dass es keine vorgelagerte Entwicklung eines den Sparprozess leitenden Kirchenbildes gegeben habe, dem die Einsparungen und Priorisierungen bzw. Posterioritäten hätten folgen sollen. Das heiße aber keineswegs, so Peters, „dass mit diesem Vorschlag eine sogenannte Kürzung nach dem Rasenmäherprinzip vorliegt. Priorisiert wurde in mehreren aufeinander folgenden Schritten im Rahmen der Durchführung einer sogenannten Aufgabenkritik.“ Peters skizzierte auch den mehrstufigen Prozess der Aufgabenkritik und der Diskussion zwischen Oberkirchenrat und Synodalausschüssen.
Sie finden den Bericht von Direktor Stefan Werner und Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters sowie die detaillierte Priorisierungsliste und eine erläuternde Lesehilfe in der Klappbox mit den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt oberhalb dieses Textes.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Bericht des Finanzausschusses

Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses, äußerte in seinem Bericht, das Kollegium des Oberkirchenrats beweise “mit der Priorisierungsliste Führungsstärke und übernimmt Verantwortung für unsere Kirche. Aber nicht topdown, von oben herab, nicht aus dem konsistorialen Elfenbeinturm heraus, sondern in enger Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Oberkirchenrat und im Austausch mit den synodalen Ausschüssen.” Das Ergebnis sei “alles andere als ein Grund zur Freude, denn unserer Kirche werden schmerzhafte Einschnitte zugemutet. Aber der Finanzausschuss würdigt die Kraftanstrengung, die hinter diesem Ergebnis steht und mit der das Kollegium einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftssicherung unserer kirchlichen Arbeit leistet.”
Geiger würdigte, dass der Schwerpunkt der Einsparungen in der kirchlichen Verwaltung und nicht in der inhaltlichen Arbeit liege. Es sei “bemerkenswert, wie konsequent das Kollegium mit der Aufgabenkritik im eigenen Haus anfängt und Einsparmöglichkeiten markiert.”
Geiger machte deutlich, dass die Landessynode Veränderungen an dieser Priorisierungsliste vornehmen könne. Aber es müsse bewusst sein, “dass die Gesamtsumme nicht zur Diskussion steht. Wenn wir an einer Stelle weniger einsparen, müssen wir woanders stärker kürzen. Dieses Kompensationsprinzip kann nicht außer Kraft gesetzt werden, da wir sonst hinter den Einsparnotwendigkeiten zurückbleiben.”
Besonders schmerze der Verzicht auf Finanzmittel zur synodalen Maßnahmenplanung, so Geiger. Er erklärte, von 2009 bis 2019 sei die Maßnahmenplanung zumeist vollständig aus zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen finanziert worden. In den kommenden Jahren müsse jedoch “jeder Euro, den wir zusätzlich ausgeben, aus der Ergebnisrücklage genommen werden”.
Geiger wies darauf hin, dass andere Landeskirchen durch Besoldungskürzungen bei Pfarrerinnen und Pfarrern sparen bzw. diese künftig im Angestelltenverhältnis beschäftigen wollen. Der Oberkirchenrat sei der Meinung, dass der Pfarrdienst durch den Stellenabbau im Zusammenhang des PfarrPlans 2030 bereits einen angemessenen Beitrag zu den Einsparnotwendigkeiten erbringt. Der Finanzausschuss werde die Entwicklung außerhalb von Württemberg aufmerksam beobachten.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Bericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte

Maike Sachs, stellvertretende Vorsitzende des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunktsetzung, hob in ihrem Bericht die „Intensität der Beratungen“ und „das gemeinsame Vorgehen von Kollegium, Fachausschüssen und Sonderausschuss“ hervor: „Wir stehen hier intensiv im Austausch, Sie und mit ihnen alle Dezernenten geben Rechenschaft ab über die Gründe Ihrer Entscheidungen, sowie über die Gespräche, die Sie mit denen führen, die von Kürzungen betroffen sind. Hier ist niemand im Alleingang unterwegs, auch wenn manches Anliegen beharrlich vorgebracht und mehrfach intensiv diskutiert wird.“
Sachs berichtete auch über Gespräche mit der badischen Landeskirche, die aber bislang keine weiteren Kooperationsmöglichkeiten über die beiden Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog bzw. für den Dialog mit dem Islam sowie den beiden Archiven ergeben hätten. Dies verzögere auch die Überlegungen zum weiteren Weg der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen, was sich wiederum auf den Antrag Nr. 34/24 auswirke, der auf einen „zukunftsweisenden Landeskirchenmusikplan“ abziele.
Abschließend wies Sachs auf die nächsten Prozessschritte hin: „Die entscheidende Arbeit wird nun nach der heutigen Einbringung in den Fachausschüssen geschehen, ehe wir im Sommer über die Maßnahmen und im Herbst über den Nachtragshaushalt und damit über deren Wirksamwerden entscheiden.“
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht

Ruth Bauer (Alfdorf) machte deutlich, dass sie die 50-prozentige Kürzung bei der Ev. Akademie Bad Boll für unverhältnismäßig hält. Dies werde „enorm schaden“. Sie brachte Antrag 18/25 ein, die Kürzung auf 31 % zu reduzieren. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument bei den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Hans-Martin Hauch (Balingen) äußerte den Eindruck, es werde sehr ernsthaft über die 104 Mio. Euro Einsparungen gesprochen, aber kaum über die 4 Mrd. Euro Rücklagen für die Versorgung der Pfarrerinnen, Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und -beamten. Dem widersprach Harry Jungbauer (Heidenheim) in einem Zwischenruf. Das alles beruhe auf Beschlüssen dieser Synode. Auch Matthias Hanßmann (Horb a. N.) widersprach in einem Zwischenruf. Diese Diskussion sei schief. Man könne über andere Anstellungsformen sprechen. Aber hier gehe es um bestehende Verpflichtungen.
Angelika Klingel (Heimsheim) kritisierte die eingebrachten Vorschläge zu Kürzungen bei den Gemeinschaften im Diakonat und brachte den Antrag 12/25 ein, diese Kürzung auf 20 % zu deckeln. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument bei den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Siegfried Jahn (Schrozberg) legt die große Bedeutung des Evangelischen Jugendwerks dar und brachte Antrag 13/25 ein, die Kürzung beim Jugendwerk von 31 % auf 10 % zu senken. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Prof. Dr. J. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) schilderte seinen Eindruck, das jeweilige Ausmaß der Kürzungen erschließe sich inhaltlich nicht. Man dürfe die einzelnen Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Es sei wichtig, auch die inhaltlichen Aufträge der Dienste und Werke genauer zu betrachten.
Ute Mayer (Renningen) sagte, sie wolle in Kinder und Jugendliche investieren. Sie seien nicht nur die Zukunft der Kirche, sondern die Gegenwart. Sie bräuchten jetzt Freiräume und Begleitung. Sie sprach sich dafür aus, die Kürzungen beim Jugendwerk auf 10 % zu reduzieren.
Marion Blessing (Holzgerlingen), sagte, ihr fehle die Transparenz, warum das Tagungshaus des Ev. Jugendwerks Bernhäuser Forst immer wieder in Frage gestellt werde. Die Synode müsse sich fragen, was ihr solch ein Ort wert sei. Hier kämen zum Beispiel Ehrenamtliche, junge Menschen und Bläser zusammen. Das Jugendwerk (EJW) werde auch von Ehrenamtlichen getragen. Sie wünsche sich bei der Priorisierung einen Austausch mit den Ehrenamtlichen.
Christiane Mörk (Brackenheim) freute sich, dass der kirchliche Entwicklungsdienst unangetastet bleibe. Sie merkte zudem an, die Kirchenmusik sei nicht ausreichend bedacht worden, und brachte Antrag 15/25 ein, die Kürzungen bei der Hochschule für Kirchenmusik aufzuschieben, bis über eine solidarische Finanzierung bei der EKD entschieden sei. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Britta Gall (Pfalzgrafenweiler) betonte, Spardiskussionen seien immer Kirchenbilddiskussionen. Einsparungen seien sicher auch in Zukunft weiter nötig. Niemand habe Freude an Kürzungen, es sei aber Fokussierung auf das Wesentliche der Kirche nötig. Gall brachte den Antrag 10/25 ein, alle vier Tagungsstätten, die unter dem Dach „Evangelische Tagungsstätten Württemberg“ zusammengefasst sind, abzugeben. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Thomas Stuhrmann (Abstatt) sagte, das Jugendwerk (EJW) sei „die wichtigste Brunnenstube unserer Kirche“. Hier würden junge Menschen erreicht und auch für die ehrenamtliche Arbeit ausgebildet. Zudem sei das EJW ein wichtiger Brückenbauer in der Konfirmandenarbeit. Er plädierte für eine Reduktion der Kürzungen beim EJW auf 10 %.
Rainer Köpf (Backnang) betonte, es habe in den letzten Jahren viele Bemühungen gegeben, die Kirchenmusik anschlussfähig und anziehend zu machen. Mit Blick auf die Hochschule für Kirchenmusik sagte er, wenn hier gekürzt werde, werde das „alles weggewischt“. Köpf sprach auch über die Kürzungen beim Evangelischen Stift in Tübingen. Es sei ungerecht, wenn hier nur 20 % statt 31 % gekürzt werde.
Andrea Bleher (Untermünkheim) lobte die Jugendarbeit des EJW als höchst innovativ und am Puls der Zeit. Sie habe eine große Vielfalt und gebe viele Impuls in die Landeskirche, die Bezirke und Gemeinden. Das sei unschlagbar gut. Das EJW solle nur mit 10 % gekürzt werden. Bleher kritisierte auch Kürzungen beim Bibelmuseum in Stuttgart. Die Bibel müsse heute viel stärker bekannt gemacht werden, denn ihre Bekanntheit gehe zurück.
Holger Stähle (Schwäbisch Hall) betonte, die Jugendarbeit sei breit aufgestellt. Diese Breite müsse erhalten bleiben. Man müsse beim Sparen auch vernetzter denken und mit anderen Playern der Jugendarbeit zu kooperieren.
Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) kritisierte zum einen, dass in der Diskussion das EJW und die Akademie Bad Boll in einen Gegensatz gebracht würden. Beides gehöre aber zusammen und müsse zusammen gesehen werden. Er brachte zum anderen Antrag 17/25 ein, der fordert, die Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit von 31 % auf 15 % reduziert werden soll. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Jörg Beurer (Heilbronn) stellte fest, man werde sich sicher auf die meisten Kürzungen verständigen können. Man dürfe aber „die Schraube nicht überdrehen“ und müsse auch über das Tempo der Kürzungen nachdenken. Zudem brachte Beurer Antrag 19/25 ein, der darauf zielt, das Friedenspfarramt zu erhalten und bei der Akademie Bad Boll anzusiedeln. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Yasna Crüsemann (Geislingen) wies auf die große Verunsicherung hin, die aus den schnellen Veränderungen in Gesellschaft und Politik resultiert. Evangelische Akademien seien Orte der Verständigung zwischen Menschen, die sonst nicht zusammenkommen. Sie böten die Orientierung, die heute von der Kirche erwartet wird. Die vorgeschlagene Kürzung von über 50 % sei unverhältnismäßig und nicht gerechtfertigt. Crüsemann wies darauf hin, über die Hälfte der Bad Boller Teilnehmenden sei unter 35 Jahre alt. Die Akademie sei ein Leuchtturm der Landeskirche und wirke in die ganze EKD hinein. Oliver Römisch (Ditzingen) antwortet in einem Zwischenruf, der Antrag auf Aufgabe der Tagungshäuser ziele auf die Trägerschaft der Hotelbetriebe, nicht auf die inhaltliche Arbeit.
Christoph Lehmann sagte, die Priorisierungsliste sei schmerzhaft. Die freien Werke seien zu stark von Kürzungen betroffen. Dabei gehe es oft nur um sehr kleine Beträge. Dort seien aber Menschen der Landeskirche aktiv, die anpacken, sie seien eine „Schatzkammer an Gaben und Tatendrang“.
Susanne Jäckle-Weckert (Forchtenberg) wies darauf hin, Kinder und Jugendliche seien heute noch vielfältig aus den Corona-Lockdowns belastet und hätten noch viel zu verkraften. Hinzu kämen Klimakrise, Unsicherheit bei der geschlechtlichen Identität, Krieg und Terror in greifbarer Nähe. Diese Kinder bräuchten Begleitung. Das EJW habe dort enorme Möglichkeiten.
Beate Keller (Süßen) sagte, es sei noch gar nicht vorhersehbar, welche Auswirkungen die Kürzungen haben würden. Mit Bezug auf die Kürzungen beim EJW sagte sie, viele Erwachsene hielten der Kirche die Treue aufgrund ihrer Verbindung zum EJW. EJW, Akademie Bad Boll, Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt – das seien alles Arbeitsbereiche, die in die Gesellschaft hineinwirken.
Michael Schradi (Blaubeuren) sagte, natürlich meldeten sich jetzt alle mit ihren jeweiligen Bedarfen. Damit hätten alle Recht, aber jeder sei auch ergänzungsbedürftig. So gebe es auch in der Jugendarbeit andere Player, die ergänzen könnten. Es gelte, in Jugendarbeit und Bildung die Vielfalt zu fördern. Die vorgeschlagenen Kürzungen bei EJW und Ev. Akademie seien nicht zielführend.
Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) plädiert hinsichtlich der Ev. Akademie für den Erhalt der Qualität. Zudem brachte sie Antrag 14/25 ein, der auf den Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Landeskirche abzielt. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Kai Münzing (Dettingen an der Erms) sprach sich für den Erhalt der inhaltlichen Arbeit der Tagungshäuser aus, aber für die Aufgabe der Häuser an sich. Es brauche auch Orte der geistlichen Einkehr, Münzing stellte aber infrage, dass dazu die wirtschaftliche Trägerschaft des Stifts Urach nötig sei. Zudem brachte Münzing Antrag 16/25 ein, der die Auflösung der Prälaturen zum Ziel hat. Die Begründung des Antrags finden Sie oben im Antragsdokument in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Anette Rösch (Wannweil) plädierte dafür, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Es gehe darum, die Kirche zukunftsfähig zu machen. Mit Blick auf die Jugendarbeit sagte sie, der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Mitgliedern werde perspektivisch wachsen. Deshalb sei es wichtig, das Augenmerk auf die Jugend zu legen.
Peter Reif (Stuttgart) bemerkte, er finde es schwierig, die inhaltlichen Hintergründe der verschiedenen Einsparvorschläge zu durchschauen. Es sei zudem völlig offen, wie sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten Jahren entwickeln werde. Deshalb müsse im Bereich der Ruhestands-Versorgung über andere Modelle nachgedacht werden. Er mahnte, die Kürzungsdebatte gemeinsam und in Ruhe zu führen.
Christoph Reith (Winterbach) sagte, eine 31-prozentige Kürzung beim EJW sei ein schlechtes Zeichen, und plädierte für maximal 10 %.
Dr. Hans-Ulrich Probst (Tübingen) beklagte, Disruption sei en vogue. Es gebe eine Lust an der Zerstörung – nicht so jedoch in der Landeskirche. Die Lust an der Zerstörung rühre von zu wenig Begegnung, Orientierung, Zuversicht und dem Rückzug in die eigenen Filterblasen her. Dem wirke die Kirche entgegen. Es brauche dabei ein besonderes Augenmerk auf die Jugendarbeit. Es brauche Orte der Begegnung, der Debatte. Und das alles müsse man zusammendenken.
Matthias Hanßmann (Horb a. N.) sagte, er wünsche sich mehr Hoffnung und ein Bewusstsein dafür, was der Kern sei, „von dem aus wir diskutieren“. Auf der Kirche liege die Verheißung des Wortes Gottes.
Gerhard Keitel (Maulbronn) wies darauf hin, es gebe auch viel Jugendarbeit außerhalb des EJW. Auch dort leiste man solidarisch Kürzungsbeiträge. Er verwies etwa auf die 31-prozentigen Kürzungen bei den evangelischen Seminaren. Die Kürzung beim EJW bedeute keine Geringschätzung der Arbeit.
Götz Kanzleiter (Ostelsheim) mahnte, man müsse auch die Perspektive der am Rande Stehenden, der Armen und Benachteiligten einnehmen. Das dürfe man nicht vergessen. Kirche solle ihre Finanzmittel auch für die Werke der Barmherzigkeit einsetzen. Daran seien Kürzungen und Investitionen zu messen.
Renate Schweikle (Kirchheim unter Teck) ermutigte zu einem Perspektivwechsel auf die verbleibenden 70 %. Ein Blick auf die weltweite Kirche zeige, dass man auch als kleinere Kirche wirkungsvoll arbeiten könne. Sie wolle „Kirche hoffnungsstur gestalten“.
Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters reagierte auf die Aussprache mit einigen Hinweisen:
Es gebe zwei Hauptgründe für die nötigen Einsparungen. Die laufenden Erträge deckten nicht die laufenden Aufwendungen. Es gebe also ein strukturelles Defizit im Haushalt in Höhe von 40 Mio. Euro. Hinzukomme, dass für die Versorgung der Kirchenbeamtinnen und -beamten sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer eine Rücklage in Höhe von 4 Mrd. Euro nötig sei. Davon fehlte noch eine Mrd., die nun angespart werden müsse.
Peters betonte, alles, was Kirche tue, habe Wert und Wirkung. Jede Kürzung bedeute deshalb, dass die Wirkung zurückgehe. Er erklärte, zunächst habe man berechnet, welche Kürzung nötig sei, wenn in allen Bereichen gleichmäßig gespart werde – dies seien 31 %. Im Folgenden sei dann inhaltlich priorisiert und nachjustiert worden. Dies alles, jeder einzelne Posten sei in den synodalen Fachausschüssen diskutiert worden.
Peters sagte, die in den Anträgen geforderten Kürzungsreduktionen bedeute in Summe einen Betrag von 2,5 Mio. Euro. Hinzu kämen die 3 Mio. Euro, die ohnehin noch zur Erreichung des Sparzieles fehlten.
Direktor Stefan Werner antwortet ebenfalls auf die Aussprache:
Es sei zwar richtig, dass man die Auswirkungen der Einsparungen nicht genau vorhersehen könne. Ganz sicher sei aber, was geschehe, wenn man nicht spare. Dann seien die Rücklagen in 5 Jahren aufgebraucht und das Defizit werde unmittelbar den Haushalt treffen. Deshalb dürften die 104 Mio. Euro nicht wesentlich unterschritten werden.
Werner sagte, es brauche jetzt die Diskussion, wie die 104 Mio. Euro erreicht werden können, wenn die Anträge zu Veränderungen der Vorschläge jetzt in den Ausschüssen diskutiert werden.
In der Aussprache seien 30 Voten gegeben worden – das bedeute 30 verschiedene Kirchenbilder. Dies zeige, warum das Kollegium der Priorisierungsliste kein Kirchenbild zugrunde gelegt habe. Aber es sei jenseits des Sparthemas durchaus eine Diskussion zum Kirchenbild nötig.
Die Anregung, verstärkt über Kooperationen nachzudenken, begrüßte Werner, wies aber auch auf die Schwierigkeiten hin, die damit oft verbunden seien. Er erwähnte als Beispiel die schwierige Diskussion um den Standort einer badisch-württembergisch gemeinsamen Hochschule für Kirchenmusik.
Bezüglich der Ev. Akademie Bad Boll wies Werner darauf hin, es gebe zurzeit auch auf EKD-Ebene eine Diskussion über die Zukunft der evangelischen Akademien.
Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses sagte, er sei zuversichtlich, dass man die Einsparung der 5,5 Mio. Euro hinbekomme, die sich aus den noch fehlenden 3 Mio. Euro und den 2,5 Mio. Euro aus den heutigen Anträgen ergeben.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Aussprache
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Anträge

Im Rahmen der Aussprache wurden folgende Anträge eingebracht und in den Sonderausschuss für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte verwiesen:
- Antrag 10/25: Abgabe der vier Tagungsstätten. Der Antrag zielt darauf ab, alle vier Tagungsstätten, die unter dem Dach Evangelische Tagungsstätten Württemberg zusammengefasst seien, abzugeben.
- Antrag Nr. 12/25: Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg. Der Antrag zielt darauf ab, dass der Bereich „Gemeinschaften im Diakonat“ nicht so stark bespart werde wie vorgesehen, sondern “die gesamten Sparmaßnahmen – inkl. landeskirchlicher Vertrag - der Diakon*Innengemeinschaften auf 20% gedeckelt werden”.
- Antrag Nr. 13/25: Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg. Der Antrag möchte erreichen, dass der “Einsparbetrag des Evangelischen Jugendwerkes in Württemberg (ejw) von 31% auf 10 % verringert“ wird.
- Antrag Nr. 14/25: Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg. Der Antrag zielt darauf ab, die Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg “in ihren Grundfunktionen Vernetzung, Fachaufsicht, Seelsorgefortbildung und Supervision zu erhalten und die vorgesehene Sparmaßnahme auf 50% zu begrenzen.”
- Antrag Nr. 15/25: Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Der Antrag möchte erreichen, dass “die vorgesehenen Kürzungen von 31%, sprich 340.000 € der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen, zeitlich so lange” verzögert werden, “bis über eine solidarische Finanzierung der kirchlichen Musikhochschulen seitens der EKD entschieden wird. Darüber hinaus bittet die Synode den OKR, eine die Hochschule absichernde Veränderung der Kürzungsbeschlüsse mit den Ausschüssen zu beraten.”
- Antrag Nr. 16/25: Abschaffung der Prälaturen. Der Antrag zielt darauf ab, dass “die Prälaturen aufgelöst und die Aufgaben in den Oberkirchenrat integriert oder auf die Dekanatsebene verlagert werden.
- Antrag Nr. 17/25: Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit. Der Antrag zielt darauf ab, dass “die Ausgaben für die Pfarrfrauen- und Pfarrmännerarbeit um 31 % reduziert werden sollen. Wir beantragen, die Kürzung zu halbieren auf 15 %. “
- Antrag Nr. 18/25: Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll. Der Antrag möchte erreichen, dass die Kürzungsquote bei der Akademie Bad Boll (inhaltlicher Bereich) bei 31% belassen wird.
- Antrag Nr. 19/25: Erhalt Friedenspfarramt. Der Antrag zielt darauf, das ‘Pfarramt für Friedensarbeit’ nicht zu kürzen und additiv an der Akademie Bad Boll anzusiedeln und so Kosten im Infrastrukturbereich (Büro, Infrastruktur, etc.) einzusparen.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Votum: Lebendige Gemeinde

1. Dank und Blick auf die Landeskirche
"Wir brauchen einfach ausreichend Geld. Wir müssen einfach Schulden machen, dann sind alle Probleme gelöst." So ein Spitzenkandidat im Bundestagswahlkampf. Als Kirche haben wir nicht die Möglichkeit, ein Sondervermögen bzw. Darlehen aufzunehmen. Wir müssen also der Realität ins Auge sehen. Daher danken wir als Gesprächskreis "Lebendige Gemeinde" dem Oberkirchenrat für die Ausarbeitung der Kürzungsliste. Man spürt ihnen ab, dass sie um diese Vorschläge gerungen haben.
Jedoch bei allen Chancen, die in einem Konsolidierungsprozess liegen: Kürzungen bedeuten Kürzungen. Und das ist schlecht. Die Einschränkung oder Einstellung von Arbeitsbereichen bedeutet weniger Weitergabe des Evangeliums und weniger Dienst am Menschen. Wenn die Kirche an Relevanz verliert, wird auch ihre Stimme als Verfechterin des christlichen Menschenbildes leiser.
Unser Dank gilt daher allen Mitarbeitenden, deren Stellen nun zur Disposition stehen. Ihr Dienst ist wertvoll und wäre es auch in Zukunft.
Wenn wir immer nur über Kürzungen sprechen, entsteht leicht eine negative Haltung gegenüber der Landeskirche. Doch das sehen wir anders. Gerade als Arbeitgeber und Wirkungsstätte für junge Theologen, Theologinnen, Diakone, Diakoninnen und Verwaltungsmitarbeitende zeigt sich, dass wir ein zukunftsfähiger Arbeitgeber sind, eben weil wir uns den Problemen rechtzeitig stellen.
2. Kriterien für Einsparungen
Herr Werner, Herr Peters, Sie weisen darauf hin, dass die Sparmaßnahmen ohne eine grundlegende Debatte zum zukünftigen Kirchenbild erfolgten. Wir begrüßen es, über konkrete Maßnahmen zu sprechen, halten aber eine weitergehende Diskussion über Auftrag und Zukunftsbild unserer Kirche für notwendig.
Die Auswirkung der aktuellen Sparliste birgt die Gefahr, dass vor allem bestehende Strukturen konserviert werden. Dadurch könnte das kirchliche Handeln einseitig verengt werden. Sie nennen einige Kriterien für die vorgeschlagenen Kürzungen.
Deshalb müssen weitere Kriterien in den folgenden Monaten berücksichtigt werden:
- Return of Invest: Natürlich können wir im kirchlichen Kontext nicht von Rendite oder Ertrag im klassischen Sinne sprechen, aber wir sollten darüber nachdenken, wo unser Mitteleinsatz die größte Wirkung erzielt. Also wo ein eingesetzter Euro unsererseits dazu führt, dass möglichst viel inhaltliche Arbeit und Dienst am Menschen ermöglicht wird.
- Dies führt unmittelbar zu den zwei folgenden Kriterien:
- Unterstützung des Ehrenamts: Viele Ehrenamtliche beklagen: "Ihr spart, und wir müssen es ausbaden." Das dürfen wir nicht ignorieren. Gerade jetzt muss die Arbeit vor Ort gestärkt werden. Es gilt, innovative Ansätze zu fördern und bestehende Projekte – wie die EfA-Initiative – weiterzuentwickeln und nicht übermäßig zu besparen. Denn hier entfalten eingesetzte Mittel eine besonders große Wirkung.
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen: "Was man alleine nicht schafft, das schaffen wir gemeinsam." Dieser Aspekt fehlt uns bisher weitestgehend, gerade als Möglichkeit der Finanzmitteleinsparung. Zusammenarbeit bedeutet, dass wir als Landeskirche nur einen Teil bezahlen, aber die Arbeit trotzdem als landeskirchlich wahrgenommen wird. Natürlich ist es einfacher, dort zu kürzen, wo keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen. Doch dabei bleibt unberücksichtigt, dass Kooperationen finanzielle Mittel häufig verstärken. Ein kleiner Invest in ein Werk bedeutet, dass ein Arbeitsfeld oder Menschen weiterhin der Landeskirche verbunden bleiben. Dies kommt der gesamten Arbeit, ja sogar der Anzahl an Taufen zugute – ohne dass die Gesamtkosten von uns alleine getragen werden müssen. Deshalb dürfen wir jetzt nicht die Zuschüsse zu freien Werken, Missionswerken, Verbänden und Vereinen kürzen, weil unser Schaden beträchtlich und fiskalisch kontraproduktiv wäre.
- Beispielsweise möchten wir hier Unterweissach nennen: Die Kürzungen im geplanten Umfang wären nicht tragbar. Unterweissach bildet Jugendreferenten und Diakoninnen für unsere Landeskirche aus. Diese Ausbildung ist nicht nur inhaltlich wertvoll, sondern auch finanziell sinnvoll. Weil zu unseren landeskirchlichen Mitteln noch Spenden hinzukommen.
3. Konkrete Herausforderungen der Jugendarbeit
Immer mehr Kinder wachsen in einem Umfeld auf, in dem Glaube keine Rolle spielt. Für die verpflichtende Ganztagsbetreuung braucht die kirchliche Jugendarbeit neue Konzepte und unsere Gesellschaft droht sozial auseinanderzudriften. Eine schrumpfende Kirche braucht junge, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter – sie sind unsere Zukunft.
Diese Problemfelder sehen wir als zentral an.
Die Jugendarbeit des EJW adressiert all diese Herausforderungen. Hier zu sparen, wäre falsch und verantwortungslos. Die Arbeit des EJW hat eine Reichweite in die gesamte Gesellschaft und unterschiedlichste Milieus, vom Bildungsbürgertum, bis in soziale Brennpunktfamilien und Gebiete.
Daher fordern wir als LG, dass die Kürzungen beim Evangelischen Jugendwerk (EJW) auf maximal 10 % begrenzt werden. Und ich glaube, ich spreche auch im Namen aller Eltern hier, die sich wünschen, dass ihre Kinder an einer christlichen Jugendarbeit teilnehmen können.
Auch fiskalisch wäre ein übermäßiges Sparen kontraproduktiv.
Jeder Euro, den wir dem Jugendwerk überweisen, ist gut angelegtes Geld. Einerseits wurden z. B. 2023 nur 40 % des Jugendwerkhaushalts aus landeskirchlichen Mitteln bestritten, unsere Mittelaufwendungen vermehren sich also, und andererseits sind die Jugendlichen von heute die Mitarbeitenden und Kirchensteuerzahler von morgen.
4. Kompensationsgedanken
Um weitere Einsparmöglichkeiten auszuloten, sollten wir beispielsweise weiter überlegen, ob wir Tagungshäuser als Landeskirche weiterbetreiben wollen. Ist es wirklich noch Aufgabe der Landeskirche, Übernachtungsbetriebe zu betreiben, oder sollten diese in externe Trägerschaft überführt werden?
5. Zwei besondere Vermögenswerte
Zu Beginn unseres Votums stellte ich fest, dass wir als Kirche kein Sondervermögen aufnehmen können. Aber wir haben zwei besondere Vermögenswerte:
- Die vielen Menschen, die sich in aller Unterschiedlichkeit für die Verbreitung des Evangeliums in die Pflicht nehmen lassen.
- Unser größtes, besonder Vermögen: die Hoffnung. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns zur richtigen Zeit die richtigen Mittel am richtigen Ort schenkt.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Votum: Offene Kirche

Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrter Herr Landesbischof, verehrte Synodale!
Da liegen sie auf ihren Brettern und beobachten die Wellen draußen im Atlantik vor Biarritz. Die Wellen rauschen stetig heran, mal größer, mal kleiner, für das Laienauge kaum unterscheidbar. Doch die Profis kennen den Rhythmus. Da, in der Ferne, ist eine, die größer erscheint, die könnte eine gute Welle werden, und sie wird größer und größer. Jetzt schnell in den Stand aufs Brett und dann vor die Welle kommen, so gelingt eine große Wellenfahrt.
Ich verstehe unsere Anstrengungen als einen sehr engagierten Versuch, vor eine riesige Welle zu kommen. Eine Welle der Teuerung und der zu geringen Rückstellungen für die Pensionslasten. Nun ist ein heftiges Sparpaket vorgelegt. Wir können wohl nicht anders. Und doch kommt es jetzt auf die Inhalte und auf die Themen an, die wir besparen oder sogar beenden. Vor die Welle kommen bedeutet, umsichtig die Sache anzuschauen und mit Weitsicht zu handeln.
Ich sehe eine Gefahr. Ich beobachte, dass wir teilweise sehr innerkirchlich unterwegs sind, sodass Bereiche übermäßig bespart werden, die von wichtiger gesellschaftlicher Relevanz sind, Bereiche, auf die die Gesellschaft schaut. Ich erlebe in vielen Begegnungen, dass gesellschaftliche Kräfte von uns erwarten, dass wir uns als Kirche einbringen und dass wir helfen, Gesellschaft zu gestalten. Gerade in den derzeitigen politischen Verhältnissen sind Worte und Aktivitäten aus Kirche und Diakonie von gesuchter Bedeutung. Nur, sind wir uns dessen so bewusst?
Diakonie von gesuchter Bedeutung. Nur, sind wir uns dessen so bewusst?
Die Offene Kirche hat große Bedenken und Einwände, den Rotstift zu sehr an den gesellschaftsrelevanten Bereichen anzusetzen. Grundsätzlich ist die Leistung des Oberkirchenrats, eine so große Einsparsumme zusammenzubekommen, sehr beeindruckend und verdient bewundernde Anerkennung. Das ist wirklich ein Mammutritt gewesen, eine solche Liste zu erarbeiten. Vielen Dank! Aber jetzt müssen wir als Synode draufschauen und sehen die Notwendigkeit von Nachkorrekturen:
Akademie Bad Boll: Die Akademie Bad Boll soll laut letztem Sonderausschuss 50 % einsparen, zuerst 31 %, dann 40 %, dann 50 %. Das ist übermäßig. Wir in der OK sehen 20 % für sinnvoll an, gehen jetzt aber als Kompromiss auf 31 %. Die Landeskirche schießt sich, um es mit einem geflügelten Wort zu sagen, selbst ins Knie, wenn sie die Arbeit der Akademie so massiv bespart, weil sie sich selbst unwichtig macht. Das würde kein Unternehmen machen. Die Akademie ist hoch anerkannt, eine Marke, die Marke „Bad Boll“! Sie leistet wichtige Beiträge in den Themenfeldern Glaube, Ethik, Werte, Naturwissenschaften, Politik, Nachhaltigkeit, Bildung usw. Wo werden medizinrechtliche ethische Fragen diskutiert - ich nenne nur Sterbehilfedebatte oder die Genetik, wo KI, wo Demokratiefragen usw.? Der neue Direktor sollte eine Chance bekommen, ein neues Konzept zu entwickeln.
Diakonat: Das Diakonat ist, gerade weil die Pfarrstellen so rückläufig sind, eine ganz wichtige Säule der kirchlichen Arbeit. Das müsste man nochmal anschauen. Wir können so nicht mitgehen mit dem Umfang des Kürzungsvorschlags für die Diakonieverbände, die Geistlich-theologischen Fortbildungen (GTF) u.a. Das müsste man dringend nochmal anschauen.
Evangelische Hochschule: Auch die Evangelische Hochschule muss im Bestand gesichert bleiben. Wir unterstützen die Begrenzung der Kürzungen, wie ja schon überarbeitet.
Psychologische Beratungsstelle der Landeskirche: „Fortbildung und Supervision in seelsorgerlicher Praxis“ (FSP) ist ein sehr geeignetes Format zur berufsbegleitenden Seelsorgeausbildung, die Supervision dann äußert hilfreich auf die Arbeit in den Gemeinden passgenau ausgerichtet. Es ist sehr wichtig, dass diese Seelsorgeausbildung weiter geleistet wird, denn wir brauchen das. Und wir brauchen die Vernetzungsarbeit im Land und die Fachaufsicht über die Ökumenischen Beratungsstellen. Hier sind wir mit der vollständigen Abschaffung mit 100 % nicht einverstanden.
Friedensarbeit: Das Friedenspfarramt kostet nur eine kleine Summe, ist aber von hoher Bedeutung. Wir erfahren eine militärische Aufrüstung enormen Ausmaßes, vielleicht kommt wieder die Wehrpflicht. Und dann bespielen wir das Thema Frieden nicht mehr?
Pfarrfrauen/Pfarrmänner: Die Kürzung der Zuschüsse für die Pfarrfrauen- und Pfarrmännerarbeit halten wir bei der großen Beanspruchung des ganzen Systems Pfarrhauses für kontraproduktiv.
Vernetzte Beratung: Wir fragen uns, ob die Aufgaben der Vernetzten Beratung im Jahr 2030 wirklich erledigt sind, und denken, dass es für die Bezirke und Gemeinden weitere Beratung braucht.
Weitere kleine Punkte gibt es noch, die möchten wir jetzt bis Sommer in den Ausschüssen noch anschauen.
Wir sehen die großen Aufgaben, die vor uns liegen, aber wir geben auch zu bedenken, dass wir wichtige Bereiche brauchen, die in die Öffentlichkeit hineinwirken. Denn sonst sägen wir an unserem eigenen Ast und befördern uns unnötig in die eigene Bedeutungslosigkeit, die die Menschen in unserer Gesellschaft ja so gar nicht sehen.
Von daher denken wir, dass es jetzt die Aufgabe ist, die Punkte einzuarbeiten, die jetzt aus der Synode kommen. Dabei muss meiner Meinung nach in dieser nächsten Runde stärker dezernatsübergreifend gedacht werden. Es kann durchaus sein, dass wir Notwendigkeiten in einem Dezernat gegenrechnen sollten mit Positionen in einem anderen Dezernat.
Wir sehen die Notwendigkeit einer starken Ausgabenreduktion, aber wir warnen davor, diejenigen Bereiche über Gebühr zu besparen, die öffentlichkeitsrelevant sind und fordern hier Vorschläge für eine Korrektur.
Jeder Surfer*in weiß, vor die Welle kommt man, wenn man klug und weitsichtig in Aktion geht.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Votum: Evangelium und Kirche

Sehr geehrte Frau Foth, sehr geehrte Menschen,
Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie – welch sperrige(r) Tagesordnungspunkt/Überschrift. Das muss erklärt werden. Und das haben Sie, Herr Dr. Peters und Herr Dr. Werner und das Team dahinter gut gemacht. Und es wird nicht einfach, allen, die in der Kirche mitarbeiten, klarzumachen, dass wir nicht nur über das Sparen sprechen, sondern es tatsächlich tun müssen.
Mir ist bekannt, dass auch in den letzten z. B. 40 Jahren gespart wurde – an der ein oder anderen Stelle. Und das war sicher nicht einfach zu akzeptieren und umzusetzen, aber immer wieder wurden Sparmaßnahmen angedacht – und irgendwann war es dann doch nicht so schlimm. Und heute? Wir können nicht in eine Glaskugel schauen, aber die Zukunft ist besser vorhersehbar, ähnlich wie bei der Wettervorhersage und da schaut es nicht so rossig aus. Und ich bin mir sicher, dass wir es an vielen Stellen spüren werden. Und zwar deutlich.
Einige Felder in der Kirche werden komplett wegfallen – für manche Personen, die dieses Feld bespielt haben, werden natürlich nicht glücklich sein. Aber soll man deshalb den Sand in den Kopf stecken und sagen „ist halt so!“. Gibt es nicht andere Möglichkeiten, die Arbeit in anderer Form weiter zu ermöglichen? Manche Dinge werden z. B. vom Staat auch geleistet. Oder ein Verein oder eine Genossenschaft kann vielleicht „einspringen“. Dafür müssen aber viele Gespräche geführt werden. Und dann fragen wir uns, ob wir genügend Player finden, an anderen Lösungen mitzuarbeiten.
In der Landeskirche und beim Oberkirchenrat musste da alles genau angeschaut werden, um große Einsparungen zu finden. Ich danke allen, die sich angestrengt haben, dass wir ein benötigtes Einsparpotenzial gefunden haben. Zumindest auf dem Papier. Und ein Einsparprozess kostet vielleicht auch Geld. Das muss man gegenrechnen. Das wurde bisher noch nicht gemacht. Das wäre auch noch zu früh. Der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Ob wir wirklich auf die 103 Mio. EUR bzw. eine Milliarde kommen? Ich habe noch Zweifel. Wir müssen die Vorschläge diskutieren und eine Mehrheit für viele „kleine“ Punkte zustimmen oder andere Lösungen finden. Sind wir dazu bereit und wird es gerecht zugehen? Ganz sicher nicht, da jeder etwas anderes sehr wichtig in der Kirche findet und erhalten oder weitergeführt werden sollte. Dazwischen sind noch die Kirchenwahlen und ein Teil der Synodalen wird die Verantwortung und Thema Einsparungen nicht mehr weiterverfolgen. Zumindest als gewählter Synodaler. Wir sollten sachlich bleiben! – auch wenn es schwerfällt. Wir können nicht so weitermachen, weil es leider ohne Geld nicht geht. Das ist Fakt. Auch wenn ich das Wort nicht super finde, ich spreche es trotzdem aus. Manches ist „alternativlos“. Und diese Einsparsumme ist diesmal unvorstellbar groß.
Eines ist für Evangelium und Kirche wichtig. Zwischen den einzelnen Aufgabengebieten, z. B. junge Christen, Diakonie, Gebäuden – sollte es möglichst gerecht zu gehen. Wenn eine Sparte, weniger sparen soll, muss es gut begründet sein, warum es gegenüber einer anderen Sparte nicht so viel kürzen soll. Und wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Da bin ich auf die Debatte gespannt. Ein Rasenmäherprinzip ist mit einer Priorisierungsliste miteinander in eine gerechte Liste miteinander „verwoben“ worden. Plus weitere Kriterien sind mit eingearbeitet worden, z. B. Gespräche mit dem Land Baden-Württemberg, anderen Trägern, die das gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen. Manche Aufgaben werden an anderer Stelle weiter verfolgt – hoffentlich mit kirchlichen oder christlichen Werten. Kürzungen werden eben oft erst durchgezogen, wenn es richtig weh tut oder es einfach nicht mehr geht. So hat es schon mein Orthopäde gesagt, als ich Probleme mit meinem Knie hatte. „Wenn es genügend weh tut, kommen sie alle wieder und dann wird gehandelt“, meinte mein Doktor. Mein Knie wurde von alleine besser, der Orthopäde hat leider noch nichts an mir verdient. Ob sich die Kirche selber finanziell helfen, heilen oder verbessern kann? Nur wenn man mit vielen Gesprächen, Treffen und Workshops am Thema dran bleibt, wird man mit einem neuen Ergebnis leben können. Wenn alle Personen, die daran mitarbeiten oder die Konsequenzen zu spüren bekommen, mit eingebunden werden, wird am Ende etwas neues vertretbaren herauskommen.
Enden möchte ich mit dem Zitat: „Zeit ist die Währung, die keiner sparen kann, aber jeder verschwendet“ – von Timo Ertel. Und ganz zum Schluss verwende ich noch ein altes Klischee, dass sich bis heute gilt: Ein Witz über Schotten – wobei ich betonen möchte, dass ich und der Gesprächskreis Evangelium und Kirche den Tagesordnungspunkt sehr ernst nehmen. Eine Person X macht Urlaub in Schottland. Er/Sie/Es fragt einen Einheimischen: „Was halten Sie eigentlich von Schottenwitzen?“ Darauf antwortet der Einheimische: „Damit sollte man sehr sparsam umgehen!“ In diesem Sinne halten wir die Sparsamkeit im Blick und werden nicht geizig. Oder wie es Herr Geiger gesagt hat – ich formuliere es etwas um: „Wir brauchen keine Besserwisser“.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 07
Landessynode 354 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des OKR - Direktor Stefan Werner, OKR Dr. Fabian Peters) (Präsentation) (PDF)
Landessynode 1 MB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des FA - Vorsitzender Tobias Geiger) (PDF)
Landessynode 68 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Bericht des SoA - Stellv. Vorsitzende Maike Sachs) (PDF)
Landessynode 54 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 10-25 - Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 12-25 - Einsparungen im Bereich der Gemeinschaften im Diakonat der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 59 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 13-25 - Verringerung Einsparbetrag Ev. Jugendwerk in Württemberg) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 14-25 - Erhalt der Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Ev. Landeskirche in Württemberg) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 15-25 - Zeitliche Verzögerung der Kürzungen von 31 % bei der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen) (PDF)
Landessynode 52 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 16-25 - Abschaffung der Prälaturen) (PDF)
Landessynode 46 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 17-25 - Reduzierung der Kürzung für die Pfarrfrauen-, Pfarrmänner- und Pfarrfamilienarbeit) (PDF)
Landessynode 203 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 18-25 - Reduzierung der Kürzung inhaltlicher Bereich Akademie Bad Boll) (PDF)
Landessynode 48 KB TOP 07 - Haushaltskonsoliderungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Antrag Nr. 19-25 - Erhalt Friedenspfarramt) (PDF)
Landessynode 49 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 87 KB TOP 07 - Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie (Lesehilfe Priorisierungsliste) (PDF)
Landessynode 76 KB
Votum: Kirche für morgen

Eine Sache kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an die vielen Diskussionsrunden der letzten Monate denke. Als Sie, Herr Werner, im Sonderausschuss über den Vorschlag gesprochen haben, die Chauffeure für Bischof und Prälaten abzuschaffen, ging es zwar auch um Zahlen und den Einsparbetrag, aber ein anderer Aspekt ist mir noch viel mehr in Erinnerung geblieben: Sie haben erzählt, wie Sie mit dem Landesbischof zusammen mit dem Zug bei einer Tagung angekommen sind und dann nach und nach andere Kirchenleitende in dicken Limousinen vorgefahren sind. Sie haben berichtet, dass sie beide das Gefühl hatten, irgendwie passt das nicht mehr in die Zeit, irgendwie passt das nicht mehr zu unserem Leitungsverständnis, zu dem, wie wir Kirche verstehen und in Zukunft sehen wollen.
Das hat mir gut gefallen. Weil das genau das Thema ist, wo wir von Kfm ansetzen möchten. Ja, vieles passt nicht mehr in die Zeit. Eine Kirche in der Transformation muss sich grundlegend verändern, wir müssen Haltungen hinterfragen und neu definieren.
Spardiskussionen sind Kirchenbilddiskussionen! Das sehen wir als Kirche für morgen nach wie vor so! Wir sind deshalb enttäuscht, dass Sie jetzt dieser Kirchenbilddiskussion eine so klare Absage erteilen. Um des lieben Friedens willen der kirchenpolitischen Pole diskutieren wir lieber nicht, was für ein Bild wir für die Zukunft der Kirche sehen. Wir optimieren lieber das System, wir optimieren bis an die Grenzen des Machbaren, wir optimieren, bis Arbeitsbereiche faktisch kaum mehr arbeitsfähig sind, wir optimieren, bis an die Belastungsgrenze der Mitarbeitenden, usw. Sie sprechen von einem ausgewogenen Entwurf. Das mag einigermaßen stimmen. Alle müssen ihren Beitrag einbringen. Trotzdem – wir halten diesen Weg für falsch. Die Optimierungs-Logik reicht für eine zukunftsfähige Kirche nicht aus. Spardiskussionen ohne Kirchenbilddiskussionen sind uns zu passiv. Passivität bedeutet Stillstand. Wer passiv ist, kann nur reagieren, wer gestalten will, muss aktiv werden und wissen, wo er hin will.
Was wir uns da als Gesprächskreis „Kirche für morgen“ vorstellen, will ich an einigen Beispielen deutlich machen:
1. Das Beamtentum abschaffen
Die rheinische Kirche plant die Abschaffung der Beamtenverhältnisse, die EKD-Ratsvorsitzende stellt den Beamtenstatus von Pfarrerinnen und Pfarrern infrage. Das Modell passe nicht mehr zu einer deutlich kleiner werdenden Kirche, sagt der Vizepräses der Rheinische Kirche. Und es wird dort mit Einsparungen von 1 Mio. Euro pro Beschäftigten gerechnet. Ich weiß, sie rechnen ein bisschen anders. Deshalb will ich auch nicht nur auf die finanziellen Auswirkungen blicken. Prälat zur Nieden aus Kurhessen-Waldeck sagt: „Im Kern geht es um ein Kirchenbild: Wir sollen Menschen anziehen, die Flexibilität nicht scheuen. Als angestellte Person kann man ohne Schwierigkeiten für einen anderen Arbeitgeber arbeiten und später wieder zurückkehren - das ist für die Kirche gut, weil ein Wechsel neue Horizonte eröffnet.“
Das System nicht weiter optimieren, sondern den Systemwechsel vollziehen, das ist jetzt dran!
2. Schwerpunkt Jugendarbeit
Mit einer klaren Zielsetzung sind wir als „Sonderausschuss für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte“ vor 5 Jahren gestartet. Das Ziel „Schwerpunktsetzung“ haben wir beim Sparen jetzt „etwas“ aus den Augen verloren.
Wenn wir aber über Priorisierung sprechen, dann möchte Kirche für morgen einen klaren Fokus auf die Jugendarbeit und die Ehrenamtlichen richten. Jugendarbeit muss ein Schwerpunkt einer Kirche der Zukunft sein und bleiben und muss deshalb überproportional gefördert werden. Junge Menschen sind nicht nur die zukünftigen Erwachsenen, sondern sie sind die Kirche von heute. Jugendliche wollen Kirche mitgestalten, sie wollen neue Konzepte und Formate ausprobieren und so ihren Platz in unserer Kirche finden. Das braucht auch in schwieriger finanzieller Lage ausreichende Mittel. Deshalb ist es gut, dass wir in den Religionsunterricht, in die Ev. Hochschule und die Müttergenesung investieren. Aber wir fordern darüber hinaus, dass wir die Kürzungssumme beim Ev. Jugendwerk auf 10 % reduzieren. Das EJW steht als größter Mitgliedverband innerhalb des Landesjugendrings für 35.000 Ehrenamtliche in den Gemeinden und Kirchenbezirken. Das EJW ist dabei wichtiger Unterstützer, Kommunikator und Impulsgeber.
3. Beine statt Steine – das Thema Tagungsstätten
Der Beschluss, eine weitere Tagungsstätte abzugeben, ist schon länger gefallen. Das Kollegium hat sich relativ schnell auf den Bernhäuser Forst festgelegt, was wir bis heute nicht nachvollziehen können.
Für den Erhalt der Tagungsstätte „Bad Boll“ argumentieren sie vor allem mit der „Marke Bad Boll“. Ganz ehrlich: in Zeiten, in denen es in Gemeinden um den Verkauf von Gemeindehäusern und Kirchengebäuden geht, ist dieses Argument nicht haltbar.
Ob Bernhäuser Forst oder Bad Boll - wir fragen uns ganz grundsätzlich: sind mit Kirchensteuern subventionierte Hotelbetten, unter der Woche für Daimler und Co., in Zeiten knapper Kassen noch verantwortbar? Müssen wir nicht viel mehr in inhaltliche Arbeit, in die Menschen, die Ehrenamtlichen, die Jugendlichen investieren? Eine Frage der Priorisierung!?
Wir werden in der Aussprache einen Antrag einbringen, der die Aufgabe aller Tagungsstätten fordert. Oder vielleicht sind auch alternative Trägerschaften denkbar. Ist Akademiearbeit in Zukunft auch ohne Tagungsstätte möglich? Zum Beispiel als Stadtakademie hier mitten in der Landeshauptstadt?
4. Schlanke Strukturen und Verwaltung
Vermutlich sind wir uns an dieser Stelle recht schnell einig: Eine kleiner werdende Kirche braucht eine schlanke und effektive Verwaltung. Da haben wir schon einiges auf den Weg gebracht: zum Beispiel die Verwaltungsreform. Auch wenn es da noch kräftig ruckelt, wir sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Auch die Synode kann selbst einen Beitrag leisten. Die Reduzierung der Sitzungstage war richtig und muss auf jeden Fall beibehalten werden. Sicher wird die nächste Synode auch über das Thema Verkleinerung der Synode nachdenken. Die Aufgabe der Stuttgarter Prälatur bringt ebenfalls Einsparungen. Wir möchten hier gerne noch weiter gehen und schlagen vor, die Ebene der Prälaturen ganz abzuschaffen. Auch dazu bringen wir einen Antrag ein. Die Kirche der Zukunft wird eine Ehrenamtskirche sein und lebt vor Ort. Wir setzen auf die Leitungskompetenzen der mittleren Ebene und möchten diese stärken und ausbauen.
Vier Themen, die für Kirche für morgen beispielhaft für einen mutigen Weg in die Zukunft stehen. Unsere Kirche im Wandel wird sowieso schon bald anders aussehen, also reden wir lieber jetzt schon über ein Bild der Kirche für übermorgen.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
TOP 08 Aktuelle Stunde
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 08
„Krieg und Frieden im Horizont internationaler sozialer Gerechtigkeit“

Das Thema der Aktuellen Stunde lautet:
„Krieg und Frieden im Horizont internationaler sozialer Gerechtigkeit“
Im Moment werden im Bundestag riesige Geldsummen für Rüstungsausgaben bewilligt und in den Koalitionsverhandlungen wird die Existenz des Entwicklungsministeriums in Frage gestellt. Ähnliches ist in vielen Ländern zu beobachten. Die US-Regierung zieht sich aus internationalen Hilfen, z.B. USAID, vollkommen zurück. Wir sehen durch die weltweite Erhöhung der Rüstungsausgaben und die gleichzeitige Reduzierung der Entwicklungshilfen eine massive Verschiebung der Gerechtigkeit in der Welt. Wie stellt sich die Evangelische Kirche zur Frage sozialer Gerechtigkeit und Friedenssicherung im Zusammenhang mit der massiven Erhöhung der Rüstungsausgaben?
Christiane Mörk (Brackenheim) betonte, dass die Entwicklungszusammenarbeit und ihre Akteure, darunter die Kirchen, in vielen Gesellschaften ein Schlüssel zu Stabilität und Frieden seien. Sie trug ergänzend aus der Pressemitteilung von Brot für die Welt vom 26. März 2025 zur Diskussion um den Fortbestand des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anlässlich der Koalitionsverhandlungen vor (Anm. d. Red.: https://www.brot-fuer-die-welt.de/pressemeldung/2025-wertegeleitete-zusammenarbeit-nur-mit-eigenstaendigem-entwicklungsministerium/). Die Synodale erklärte, dass auf der anderen Seite zivilgesellschaftlich Engagierte immer mehr zum Ziel von Angriffen würden. Es sei absurd, die Mittel zur Vorbeugung von Krieg und Gewalt zu senken. Mörk verwies abschließend auf das Positionspapier von Brot für die Welt und Misereor. (Anm.d. Red.: https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/downloads/Allgemein/Impulspapier_Koalitionsverhandlungen_BfdW-Misereor.pdf).
Yasna Crüsemann (Geislingen) berichtete vom kürzlichen Besuch der Führungskräfte des Lutherischen Weltbundes; die Mitglieder hätten die Bedeutung der Streichung von USAID erläutert: Suppenküchen würden geschlossen, insbesondere in den großen Flüchtlingslagern sei die medizinische Versorgung und die Ernährung gefährdet. Alle Hilfsorganisationen seien betroffen. Als Folge würden unzählige Menschen sterben, viele sich auf die Flucht begeben. Damit steige z.B. weltweit auch das Risiko von Pandemien. Hinzu komme die Kürzung von staatlichen Mitteln in Deutschland. Crüsemann betonte, wie wichtig der Einsatz der Kirche als weiterhin verlässliche Partnerin sei.
Dr. Gabriele Schöll (Aalen) warf die Frage auf, was genau unter Frieden zu verstehen sei, nach dem sich alle sehnten. Zum einen ein Ende der Kämpfe und ein Leben in Sicherheit, aber zum anderen, biblisch gesehen, noch mehr. Sie erinnerte an die Zwei Reiche Lehre Martin Luthers. Danach lebten wir alle „jenseits von Eden“, und die weltlichen Gesetze seien Notverordnungen für die Zwischenzeit zwischen Sündenfall und Jüngstem Gericht. Friedensbemühungen müsse man dennoch unterstützen.
Markus Ehrmann (Rot am See) sprach darüber, dass die Themen Krieg, Frieden und soziale Gerechtigkeit leider keine aktuellen Themen seien. Unser Auftrag, persönlich und als Kirche, sei es, den Wert des Friedens immer aktuell zu halten. Ihm selbst werde immer mehr bewusst, dass der Friede, in dem er lebe, nicht die Normalität sei. Generell sei Frieden weniger normal, als wir annähmen. Der Auftrag der Kirche bestehe darin, für den Frieden einzutreten, auf Jesu Frieden hinzuweisen; zudem Menschen zum Glauben einzuladen, da daraus Frieden in der Welt erwachse. Schließlich dürfe Kirche nicht besserwisserisch Vorschriften machen, wie mit Aggressoren umzugehen sei.
Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) erklärte, es gehe darum, die Friedensfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten, die neu vor der Frage stünde, wen sie beschützen müsse. Sie beobachte eine zunehmende Militarisierung in der Gesellschaft. Bildung und Friedensbereitschaft seien nicht einfach gegeben, sondern kulturelle Errungenschaften des christlichen Abendlandes. Sie sei besorgt um eine Kultur, die keine Probleme damit habe, aufzurüsten, und zugleich den Menschen, die zu ihr flüchteten, weil sie keinen Frieden hätten, keinen Platz gewähre wolle – beides hinge zusammen. Die Ressource der Kirche sei das Gebet, und sie müsse Orte der Begegnung für Menschen schaffen, die sich für den Frieden einsetzten. Abschließend trug sie das Gedicht „Der Ort, an dem wir recht haben“ von Jehuda Amichai vor.
Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) ergänzte die Diskussion um den Aspekt der Rohstoffe, die wir für unseren Lebensstandard brauchten. Rohstoffreiche Regionen weckten Begehrlichkeiten; als Beispiele nannte er die Ukraine, Guatemala, Grönland oder Bolivien. Man müsse den Zusammenhang dieser Ressourcen mit den Konflikten betrachten und sich fragen, was wir verbrauchten, und womit man seinen Bedarf, z.B. bei Handys, decke.
Holger Stähle (Schwäbisch Hall) berichtete von seinem Eindruck, dass viel Angst und Verunsicherung herrschten, und diese für bestimmte Interessen und politische Stimmungen genutzt würden. Kirche sei als Hoffnungsort gefragt. Es dürfe nicht sein, dass man die Ärmsten der Armen allein lasse, um für die eigene Sicherheit sorgen zu können – und diese später gegebenenfalls an den Außengrenzen der EU zurückzuweisen, wenn sie in Richtung EU flüchteten. Die Kirche und ihre Mitglieder seien als Hoffnungsjüngerinnen und -jünger Jesu gefragt.
Rainer Köpf (Backnang) verwies auf seine Erfahrungen, dass er als einer der wenigen in seiner Schulklasse seinerzeit zur Bundeswehr gegangen sei. Dem christlichen Menschenbild nach sei der Mensch zwar wunderbar geschaffen, aber er trage auch einen dunklen Abgrund in sich. Es brauche daher Polizei und Militär, um die Schwachen zu schützen. Der Platz eines Christen sei die Mitte des Tuns, und nicht zuletzt das Gebet.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 09
Antrag auf Einrichtung eines gemeinsamen Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) angenommen

Die Landessynode hat auf ihrer Frühjahrstagung dem vom KGS-Ausschuss eingebrachten Folgeantrag Nr. 03/25 mehrheitlich zugestimmt und damit auch dem Zusammenschluss der KDA in Württemberg und Baden und der Einrichtung einer/s gemeinsamen Beauftragten der Landeskirchen.
Annette Sawade, die Vorsitzende des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung (KGS), berichtete auf der Frühjahrssynode über die Beratungen zum Antrag Nr. 30/21 „Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) unter geänderten Bedingungen“, vom 2. Juli 2021.
Sawade machte deutlich, dass sich die Situation seit Antragstellung strukturell, finanziell und personell bereits ziemlich verändert habe. In der letzten Ausschuss-Sitzung am 27. Februar 2025 hat der KGS daher beschlossen, den Folgeantrag Nr. 03/25 „Kirche in der Arbeitswelt“ in der Frühjahrssynode zur Abstimmung einzubringen.
Dieser Folgeantrag bekräftigt den Zusammenschluss der KDA in Württemberg und Baden und die Einrichtung einer gemeinsamen Beauftragten-Stelle der Landeskirchen Baden und Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Auch für eine finanzielle Beteiligung der württembergischen Landeskirche über 2030 hinaus spricht sich der KGS aus. Zusätzlich fordert der KGS, die württembergische Expertise künftig sicherzustellen, und zwar in Person einer/s „regionalen“ Beauftragten, die/der am Wirtschaftsstandort Stuttgart ansässig und für die württembergische Arbeitswelt zuständig ist.
Sawade bat die Synode schließlich um ihr Votum, eine für Baden und Württemberg in finanzieller und inhaltlicher Hinsicht akzeptable Lösung zu finden
Aussprache
Der Synodale Thorsten Volz (Backnang) warf die Frage auf, in welche Richtung sich die Landeskirche entwickeln möchte: sich aus der Gesellschaft zurückziehen oder wie Salz in der Erde in die Gesellschaft hineinwirken. Dabei verdeutlichte er, dass beim KDA keine Reduzierung um 31 Prozent, sondern um 200 Prozent bei Pfarrstellen geplant sei.
Die Synodale Hannelore Jessen (Neuenstadt) forderte die Landessynode auf, beim KDA nicht nur an den Wirtschaftsstandort Stuttgart zu denken. „Vergesst Württembergs Norden nicht!“, rief sie dem Plenum zu.
Dass das Geld, das für den KDA aufgewendet wird, in anderen Bereichen fehlen wird, mahnte der Synodale Dr. Thomas Gerold an.
Kritik übte die Synodale Heidi Hafner (Sindelfingen) daran, dass das Feld „Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt“ bereits jetzt ziemlich vernachlässigt sei. Früher habe es sogar noch eine Praktikumsstelle gegeben. Sie verwies dabei auf die katholische Kirche, die in diesem Bereich immer noch sehr aktiv sei und sogar noch mehr Man-Power in die Betriebsseelsorge stecke. Hafner plädierte dafür, “dieses Feld nicht komplett platt zu machen”.
Beschluss
Der Folgeantrag Nr. 03/25 auf Einrichtung eines gemeinsamen KDA beider evangelischer Landeskirchen wurde mit Mehrheit bei 16 Enthaltungen angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 09 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 10 Ergänzung zum Gottesdienstbuch für die Evangelische Landekirche in Württemberg, Zweiter Teil: Sakramente und Amtshandlungen, Teilband Die kirchliche Trauung 2020
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 10
Landessynode 75 KB TOP 10 - Ergänzung des Gottesdienstbuchs Die kirchliche Trauung (Antrag Nr. 11-25 - Ergänzung Kirchenbuch Die kirchliche Trauung) (PDF)
Landessynode 53 KB TOP 10 - Ergänzung des Gottesdienstbuchs Die kirchliche Trauung (Beilage 130) (PDF)
Landessynode 881 KB
Liturgie für die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare

Die Liturgie soll als Ergänzung in das Gottesdienstbuch 'Die kirchliche Trauung' aufgenommen werden und voraussichtlich zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der Antrag 11/25 wurde an den theologischen Ausschuss verwiesen.
Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider, Leiter des Dezernats „Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche“ stellte in seinem Bericht Ergänzungen zum Gottesdienstbuch „Die kirchliche Trauung“ in Form von Beilage 130 vor, in der die Liturgie für die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare erarbeitet wurde. Sie sei eine Ergänzung zur Liturgie des selbstständigen Traugottesdienstes ohne Abendmahl.
Unterschiede:
- Die Begrüßung und der Trausegen gelten nicht dem "Ehebund", sondern der Ehe.
- Die Traufragen werden mit „Ehefrau“ und „Ehemann“ auch für das gleichgeschlechtliche Ehepaar passend formuliert.
- Für die Schriftlesung und die Deuteworte wurden Bibeltexte ausgewählt, die zur Liebe zwischen zwei Menschen passen, die gleichen Geschlechts sind. (z.B. Rut 1,16-17).
- Die liturgischen Elemente werden dem Kasus der gleichgeschlechtlichen Trauung gemäß gestaltet.
Die Trauliturgie könne auf weiteren Formen adaptiert werden:
- Traugottesdienst mit Abendmahl
- Trauung mit einem geschiedenen oder nichtgetauften Partner
- Familienbezogene Trauung und Ehejubiläum
- Trauung von zwei Personen, von denen mindestens eine nicht-binär ist.
Abschließend stellte Schneider den Antrag Nr.11/25, der von ihm vorgestellten Ergänzungen zuzustimmen. Diese Änderung solle zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.
Aussprache
Professor Dr. Martina Klärle (Weikersheim) bedankte sich, bezogen auf diesen und TOP 23, bei allen Synodalen, bei Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und bei dem Oberkirchenrat, die daran mitgearbeitet hätten, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, im Gespräch zu bleiben und Lösungen zu finden.
Ines Göbbel schloss sich diesem Dank an und äußerte ihre Zuversicht, der Gleichstellung des Eheverständnisses und der Trauung einen Schritt nähergekommen zu sein. Sie bedankte sich ferner bei allen Bündnissen, die sich für die Sichtbarkeit und die Rechte queerer Menschen einsetzen. Die Entscheidungen, die die Synode träfe, hätten direkte Auswirkungen für die Menschen in der Landeskirche. Für sie selbst habe sich ihre Zuversicht gestärkt, in einer Kirche der Geschwisterlichkeit zu sein. Abschließend bat sie um Zustimmung für die Verweisung in den TOP 10 und 23.
Ebenso bedankte sich Burkhard Frauer (Ditzingen) für die Mitarbeit und die Ausarbeitung. Er bat darum, den Entwurf zu ergänzen um die Bibelstelle aus 1. Mose 2,18: „Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ (Lutherbibel 2017). Oder alternativ um die Stelle aus Genesis 2,18: „Gott, der HERR, dachte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt.“ (Gute Nachricht Bibel). Burkhard Frauer erklärte, wer das sei, der dem Menschen entspreche oder zu ihm passe, sei Gott zu überlassen, und nicht in eine Schublade zu pressen.
Verweisung
Der Antrag 11/25 wurde an den theologischen Ausschuss verwiesen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 10 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 11
Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand bereits möglich

Kai Münzing, Vorsitzender des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, berichtete, der Ausschuss für Kirchen- und Gemeindeentwicklung sehe den Antrag Nr. 42/24 als erledigt an, da die Weiterführung von elkw-Adressen bereits möglich sei. Lediglich die flächendeckende technische Umsetzung sei noch nicht gegeben. Abschließend bitte der Ausschuss Dezernat 3, den Off-Boarding-Prozess für Pfarrpersonen zu verbessern.
Den vollständigen Bericht zu TOP 11 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 12
Landessynode 65 KB TOP 12 - Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus (Antrag Nr. 09-25 - Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus) (PDF)
Landessynode 45 KB TOP 12 - Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus (Handreichung für Pfarrer, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung von § 2 der Kirchlichen Wahlordnung) (Beilage 128) (PDF)
Landessynode 668 KB
Antrag auf Verschärfung des Kirchenwahlrechts an Rechtsausschuss zurückverwiesen
Die Landessynode hat nach einem Geschäftsordnungsantrag beschlossen, den eingebrachten Folgeantrag Nr. 09/25 „Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus“ zurück an den Rechtsausschuss zur weiteren Beratung zu verweisen. Der Antrag hat das Ziel, die Handreichung für Pfarrer, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung von § 2 der Kirchlichen Wahlordnung zu ändern.
Hellger Koepff, Vorsitzender des Theologischen Ausschusses, brachte den Geschäftsordnungsantrag ein, sich nicht mit dem als Beilage 128 vorliegenden Gesetzentwurf zu befassen, sondern diesen an den Rechtsausschuss zurückzuverweisen. Koepff begründete dies damit, dass sich herausgestellt habe, dass es noch Gesprächsbedarf gebe.
Beschluss
Die Landessynode hat nach einem Geschäftsordnungsantrag mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen, den Folgeantrag Nr. 09/25 auf Änderung der Handreichung für Pfarrer, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung von § 2 der Kirchlichen Wahlordnung zurück an den Rechtsausschuss unter Beteiligung des Theologischen Ausschusses zu verweisen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 12 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 13
Programm „Ehrenamtliche feiern Andacht“ soll fortgeführt werden

Die Landessynode hat auf ihrer Frühjahrstagung dem vom Theologischen Ausschuss eingebrachten Folgeantrag Nr. 02/25 mehrheitlich zugestimmt. Damit wurde beschlossen, dass der Oberkirchenrat das Programm „Ehrenamtliche feiern Andacht“ fortführen wird.
Der Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Hellger Koepff, berichtete auf der Frühjahrssynode über die Beratungen zum Antrag Nr. 38/24 „Ehrenamtliche feiern Andacht“. Die für das Programm zuständige 50%-Pfarrstelle soll nach Auskunft des Oberkirchenrats wegen geringer Nachfrage entfallen.
Daher brachte Koepff den Folgeantrag Nr. 38/24 zur Abstimmung ein. Ziel des Antrags ist, das Programm „Ehrenamtliche feiern Andacht“ unter der Ägide der Fachstelle Gottesdienst fortzuführen. Damit sollen Ehrenamtliche weiterhin ermutigt und befähigt werden, Andachten zu leiten. Der bereits etablierte Titel soll beibehalten werden, so Koepff.
Den Vorschlag des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung (KGE), für die Qualifizierung und Fortbildung von Interessierten eine Ehrenamtsakademie einzurichten, begrüße der Theologische Ausschuss. Ebenso wichtig sei die Vernetzung sowie die digitale und leicht auffindbare Präsentation der Angebote für die Ehrenamtsförderung.
Dazu sei allerdings eine Haltungsänderung bei den Pfarrpersonen erforderlich, betonte Koepff. Ehrenamtlichen sollten befähigt werden und auch handlungsfähig sein. Diese Rollenklärung sei eine herausfordernde Daueraufgabe, die in der Aus- und Fortbildung verankert werden sollte.
Aussprache
Gunther Seibold (Filderstadt) erinnerte daran, dass der Titel „Ehrenamtliche feiern Andacht“ so verstanden werden könnte, dass Ehrenamtliche nur Andachten feiern würden, keine Gottesdienste. Er bat darum, dass der Antragsbeschluss mit der Haltung verbunden werde, dass Ehrenamtliche auch Gottesdienste feiern. Diese sollten durch Pfarrpersonen im Rahmen ihres Kanzelrechts dazu befähigt werden. Seibold forderte eine Ermöglichungskultur, die zu stärken sei. Kai Münzing (Dettingen an der Erms) sprach sich ebenfalls für diesen Antrag im Verbund mit der Haltungsänderung aus.
In die Zukunft blickte Ralf Walter (Herbrechtingen), indem er der Kirche die Entwicklung hin zu einer Ehrenamtskirche bescheinigte, in der Ehrenamtliche noch eine viel größere Rolle als heutzutage spielen werden. Walter warb darum, das vorhandene Know-how an der Basis zu bündeln, um Menschen zu befähigen.
Auch Thomas Stuhrmann (Abstatt) sieht die Kirche zunehmend auf dem Weg zur Ehrenamtskirche. Aufgabe der Kirche sei es, engagierte Ehrenamtliche, zu schulen, zu fördern und zu begleiten. Dazu sei eine neue Diskussion erforderlich, wer in den Kirchengemeinden Gottesdienste durchführt. Wo nötig, sei ein Muss durch ein Soll zu ersetzen. Die Fortsetzung des Angebots „Ehrenamtliche feiern Andacht“ begrüße er.
Dr. Markus Ehrmann (Rot am See) verwies darauf, dass es künftig mehr Vakanzen im Pfarrdienst geben werde. Um diese Vakanzen abzufedern, würden daher dringend Ehrenamtliche gebraucht.
Beschluss
Der Folgeantrag Nr. 02/25 auf Fortführung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“ wurde mit Mehrheit bei drei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 13 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer – Das Anliegen des Antrags wurde bereits durch den Oberkirchenrat bearbeitet

Hannelore Jessen, Mitglied des Rechtsausschusses, trug den Bericht des abwesenden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Martin Plümicke, vor. Der Rechtsausschuss habe beschlossen, den Antrag Nr. 06/23 nicht weiterzuverfolgen, da das Anliegen bereits durch den Oberkirchenrat bearbeitet worden sei.
Maßnahmen seien eine moderate Erhöhung der Vertretungsvergütung und die Bereitstellung von Dienstaufträgen für Kirchenbezirke. Hinsichtlich der Frage nach Vertretungen im Religionsunterricht durch Pfarrpersonen im Ruhestand, empfehle der Oberkirchenrat eine Mindestdauer von vier Wochen, um Mehrausgaben zu vermeiden.
Den vollständigen Bericht zu TOP 14 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Antrag zu Teilzeitregelungen und zur Residenzpflicht wird nicht weiterverfolgt.

Hannelore Jessen, Mitglied des Rechtsausschusses, trug den Bericht des abwesenden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Martin Plümicke, vor. Der Rechtsausschuss habe einstimmig beschlossen, den Antrag Nr. 08/23 nicht weiterzuverfolgen.
Laut Oberkirchenrat seien bereits weitgehende Teilzeitregelungen möglich. Die Residenzpflicht für Vikare und Vikarinnen sei bereits abgeschafft worden, jedoch solle sie für Pfarrerinnen und Pfarrer zum jetzigen Zeitpunkt beibehalten werden. Das Thema werde bereits auf EKD-Ebene behandelt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 15 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 16
Keine rechtlichen Vorschriften der Wochenarbeitszeit für Pfarrerinnen und Pfarrer

Hannelore Jessen, Mitglied des Rechtsausschusses, trug den Bericht des abwesenden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Martin Plümicke, vor. Der Rechtsausschuss habe einstimmig beschlossen, den Antrag Nr. 25/23 nicht weiterzuverfolgen, da die freie Gestaltung des Dienstes, bewahrt werden solle.
Der Antrag zielte darauf ab, das Württembergische Pfarrergesetz zu ändern, um geregelte Wochenarbeitszeit mit mindestens einem freien Tag festzusetzen.
Wortmeldung:
Die Erstunterzeichnerin Marion Blessing (Holzgerlingen) bedauerte die Entscheidung. Sie habe den Antrag zusammen mit jungen Pfarrerinnen und Pfarrern gemeinsam erarbeitet. Vieles habe sich geändert, vor allem durch den Pfarrplan 2030. Freie Tage zu nehmen, sei in der Realität nicht einfach möglich. Sie hoffe, in den nächsten Jahren würde sich an dieser Stelle etwas tun.
Den vollständigen Bericht zu TOP 16 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 17
Polizeiliches Führungszeugnis bleibt Voraussetzung für die Schließung von Arbeitsverträgen

Hannelore Jessen, Mitglied des Rechtsausschusses, trug den Bericht des abwesenden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Martin Plümicke, vor. Der Rechtsausschuss habe einstimmig beschlossen, den Antrag Nr. 32/24 aufgrund des Gewaltschutzgesetzes und der öffentlichen Wahrnehmung nicht weiterzuverfolgen.
Der Antrag zielte darauf ab, das Arbeitsrechtsregelungsgesetz dahingehend zu ändern, dass Arbeitsverträge unter der auflösenden Bedingung geschlossen werden könnten, falls das polizeiliche Führungszeugnis, ohne Verschulden der anzustellenden Person, nicht fristgerecht vorgelegt werden könne.
Wortmeldung:
Der Erstunterzeichner Hellger Koepff (Biberach) kann die Entscheidung juristisch nachvollziehen, gab jedoch zu bedenken, dass dadurch die Anstellung von Arbeitskräften erschwert werden würde.
Den vollständigen Bericht zu TOP 17 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung bleibt unverändert

Hannelore Jessen, Mitglied des Rechtsausschusses, trug den Bericht des abwesenden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Martin Plümicke, vor. Der Rechtsausschuss habe mehrheitlich beschlossen, den Antrag Nr. 10/23 aufgrund juristischer Bedenken nicht weiterzuverfolgen.
Der Antrag zielte darauf ab, zum einen den Vorstand der Schulstiftung auf fünf Mitglieder zu reduzieren und zum anderen mit Mitgliedern des Kollegiums und der Landessynode zu besetzen. Der Vorstand ist personell identisch besetzt wie das Oberkirchenrats-Kollegium.
Wortmeldung:
Der Erstunterzeichner Gerhard Keitel (Maulbronn) bedauerte, dass das Recht politische Veränderungen verhindere. Er erwünsche sich die Möglichkeit einer besseren Beteiligung der Synode. Er schlug vor, die Schulstiftung Stuttgart und die Schulstiftung der Landeskirche zusammenzulegen, wodurch eine neue Satzung beschlossen werden müsste, die den Wünschen der Synode mehr entsprechen könnte.
Den vollständigen Bericht zu TOP 18 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Zusammensetzung des Vorstands der Seminarstiftung bleibt unverändert

Hannelore Jessen, Mitglied des Rechtsausschusses, trug den Bericht des abwesenden stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Martin Plümicke, vor. Der Rechtsausschuss habe mehrheitlich beschlossen, den Antrag Nr. 11/23 aufgrund juristischer Bedenken nicht weiterzuverfolgen.
Wortmeldung:
Der Erstunterzeichner Gerhard Keitel (Maulbronn) bedauerte diese Entscheidung. Er verwies auf seine Wortmeldung zu TOP 18
Den vollständigen Bericht zu TOP 19 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 20
Landessynode 28 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Situation der Kirchenmusik - Bericht Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Response OKR Dr. Schneider) (PDF)
Landessynode 111 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Zusammenfassungen Stationen Markt der Möglichkeiten - One Pager) (PDF)
Landessynode 580 KB




Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 20
Landessynode 28 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Situation der Kirchenmusik - Bericht Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Response OKR Dr. Schneider) (PDF)
Landessynode 111 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Zusammenfassungen Stationen Markt der Möglichkeiten - One Pager) (PDF)
Landessynode 580 KB
Von der Kraft des Singens und Musizierens
Am Vormittag des zweiten Sitzungstages befassten sich die Synodalen in Vorträgen und vielen praktischen Demonstrationen mit der Lage und den Potenzialen der Kirchenmusik in der Landeskirche.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 20
Landessynode 28 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Situation der Kirchenmusik - Bericht Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Response OKR Dr. Schneider) (PDF)
Landessynode 111 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Zusammenfassungen Stationen Markt der Möglichkeiten - One Pager) (PDF)
Landessynode 580 KB
Bericht von Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke

Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke hob in seinem Bericht den Wert der menschlichen Stimme hervor. Sie sei „das Instrument, das wir immer dabeihaben, das uns Gott in die Wiege gelegt hat. [...] Durch die Seele/Kehle spricht Gott selbst in seiner Schöpfung, fängt die Schöpfung an, miteinander zu kommunizieren. Gottes Wort wird laut, wird Klang, transportiert seine Botschaft, inhaltlich in Wort und emotional in Tat, von Herz zu Herz gehend, das Gegenüber ansprechend.“
Die Kraft und Wirkung der Kirchenmusik bestehe darin, dass die „Klang gewordene Botschaft“ immer von Personen komme und personalisiert sei. Botschaft und Person seien verbunden. „In dieser Form des Weitergebens wird die Botschaft erst authentisch“.
Kirchenmusik in ihrer ganzen Vielfalt sei „ein Teil der DNA evangelischer Christinnen und Christen.“ Hierin liege „eine große Chance der Kirchenmusik für unsere Landeskirche: Menschen mit Gottes Nähe zu beglücken.“
Hanke betonte, die Landessynode habe „ganz wesentlich an den Transformationsprozessen der Kirchenmusik in den letzten 30 Jahren mitgewirkt“, etwa mit der Erweiterung der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen (HKM) um den popularmusikalischen Kirchenmusikstudiengang und das Kinderchorleitungsseminar. Hier sei die HKM deutschlandweit Vorreiter.
Reichweite und Vervielfältigungswirkung gelinge der Kirchenmusik durch „Begeisterte, dazu Berufene, durch eine Vielzahl von Begabten: Ehrenamtliche, Neben- und Hauptberufliche. Sie sind der Schatz, ‚das Kapital‘ dieser Kirche, der Same, der gesät ist und immer wieder für Wachstum sorgt.“ In einer langen Tradition gäben Generationen ihre Begeisterung weiter, so Hanke. Sie ließen sich „in Dienst nehmen, von SEINER Kirche, dem Gottes-Dienst verpflichtet, Soli Deo Gloria.“ Daran habe sich nichts geändert. Mit Blick auf den Nachwuchs sagte Hanke: „Die junge Generation stellt sich der Aufgabe, die Jahrzehnte lange stilistische Fokussierung auf klassische Musik um die Popularmusik zu ergänzen. Vielerorts erleben wir nun das fruchtbare Miteinander, das ‚Sowohl als auch‘.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 20
Landessynode 28 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Situation der Kirchenmusik - Bericht Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Response OKR Dr. Schneider) (PDF)
Landessynode 111 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Zusammenfassungen Stationen Markt der Möglichkeiten - One Pager) (PDF)
Landessynode 580 KB
„Sich im Raum der Musik verlieren dürfen. Das Unglaubliche der Kirchenmusik“ - Vortrag von Prof. Dr. Dr. Günter Thomas

Prof. Dr. Dr. Günter Thomas, Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie, Ethik und Fundamentaltheologie an der Ruhr Universität Bochum, analysierte in seinem Vortrag zunächst verschiedene Liedgattungen des Alten Testaments und hob dabei besonders die Psalmen hervor. Die gesungene Dichtung sei zu einem „Medium der Suche, Gott zu verstehen”, geworden. „Musik und Dichtung werden zu einem herausgehobenen Ort des so öffentlichen wie intimen Nachdenkens über den eigenen Ort in der Gottesgeschichte”, so Thomas.
Dank, Bitte, Lob und Klage seien nicht nur Liedgattungen, sondern „im Lied dargelegte Existenzhaltungen gegenüber Gott. Sie sind Glaubensgestalten. Darum darf das Leben mit Gott gesungenes, musiziertes Leben sein.“ Christlicher Glaube sei „Gast im reichen Erfahrungsraum, im überaus konfliktreichen Erkenntnisraum, im polyphonen theologischen Klangraum Israels.“
Thomas hob in seinem Vortrag einige Besonderheiten des Singens hervor. Dabei würden „bewährte und eingespielte Grenzen verwischt. Die Grenze zwischen Aktivität und Passivität, die Grenze zwischen Handeln und Erleben, die Grenze zwischen Tun und Lassen, zwischen Selbstbestimmung und Bestimmt-Werden, und nicht zuletzt die Grenze zwischen rationalem Handeln und dem reißenden Fluss der Gefühle. Hören und Sprechen verschwimmen im gemeinsamen Gesang. [...] Wir werden unser und anderer Instrument und lassen uns spielen. [...] Im Singen entschließen wir uns, uns entführen zu lassen. Mitsingend lassen wir uns in ganze Gefühlslandschaften, auf ferne Kontinente der Imagination entführen.“
Für eine Kirche, die sich in „weiten Landschaften der Gottesvergessenheit“ bewege, böten die Musik und der Gesang „unglaubliche Möglichkeiten“, so Thomas. Singen und Musik erlaubten es, so Thomas, dass „Fragende, Zweifler, Skeptiker, heimlich verehrende Spötter, Verhalten-Neugierige, Angefochtene und spirituell Erschöpfte, theologisch Gelangweilte und in Sachen Gott Ahnungslose, dass diese alle, die Menschen dieser bunten Gemeinschaft in der Kirche einen Ort finden.“ Im Raum der Musik und im Singen müsse man nicht glauben, was man alles höre und sage: „Das ist die Pointe. Das ist die Chance. Das für eine begrenzte Zeit geliehene Wort, die mit der Musik befristet angeeignete Stimmung erlauben, Glauben und Gottesrede auszuprobieren. Im Modus des ‚Als-ob‘ kann das Kleid des Glaubens geliehen, gemietet, getestet werden. Man kann ausprobieren, wie sich dies anfühlt.“
Im Lied könne Glaube ausprobiert werden. Doch sei dies „schon ein Vollzug, kein Räsonieren, kein Diskutieren, kein Debattieren, kein reines Beobachten. Wer singt, steckt im Ereignis, im Vollzug der Wirklichkeit. Wer singt, existiert im Jetzt der Kommunikation des Glaubens– auch wenn es im Modus des ‚Als-ob‘ stattfindet.“
Darum finde sich im Raum der Kirchenmusik „die für die Zukunft der Kirche so wichtige Verbindung einer Niederschwelligkeit in Sachen Zugänglichkeit und einer inhaltlichen Prägnanz.“ Es werde ein einladender [...] die Freiheit und die Intimität des spirituellen Lebens respektierender Praxisraum geschaffen. „Alle, die Gott tief Vertrauenden und die Skeptiker, dürfen Unglaubliches singen. Was kaum zu glauben ist, darf gesungen werden. Dass der unglaubliche Glaube einen Ort hat, ist das Unglaubliche der Kirchenmusik.“
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 20
Landessynode 28 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Situation der Kirchenmusik - Bericht Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Response OKR Dr. Schneider) (PDF)
Landessynode 111 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Zusammenfassungen Stationen Markt der Möglichkeiten - One Pager) (PDF)
Landessynode 580 KB
Antwort von Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider

Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider, Leiter des theologischen Dezernats, antwortete mit einem Statement auf Prof. Dr. Dr. Günter Thomas. Schneider hob den Aspekt des Tuns im Musizieren und Singen hervor und verwendete dafür den Begriff des “Musicking”, den der Musikwissenschaftler Christopher Small geprägt habe. Er wolle zudem die sozialen Aspekte betonen: “Unter welchen Bedingungen entsteht ein Werk oder ein Song? Was und wer muss alles zusammenkommen, damit etwas gehört wird? Was passiert mit den zusammen musizierenden Menschen? Den Zuhörenden?”
Schneider sagte, Thomas’ Vortrag lege “Wert auf die Verstehensdimension, genauer auf die Erschließungsfunktion von Musik, vor allem vom Lied mit Text”, und bleibe damit “im intellektuellen Bereich”. Dem stellte Schneider entgegen: “Es ist, denke ich, noch vielschichtiger, als Günter Thomas dargestellt hat. Ich meine, dass sich Musik in der Kirche zuerst aus dem gemeinsamen Singen oder Spielen speist, noch vor dem Inhalt. Dass der Inhalt die Gefühle regiere, das ist ein Wunsch, den die Protestanten hegen. Sogenannte schöne Lieder und Stücke gehen aber zuerst auf die Emotionen.” Mit Blick auf das Beispiel einer Bach-Passion sagte Schneider, die “Schönheit liege jenseits des Verstehens [...] Vielleicht ist es ein Irrweg, zuerst zu verstehen und dann zu genießen. Es ist wie der Glaube: Er bewegt sich vor allem Verstehen”.
Schneider würdigte Thomas’ Gedanken, dass man sich beim Singen Texte und Inhalte aneigne, die man nicht sagen können würde. Thomas: „Im Raum der Musik und im Singen muss man nicht glauben, was
man alles so sagt. Das ist die Pointe.“ Man singe das Gegebene. Unter der Hand kämen damit “Inhalte in den Sinn und die Sinnlichkeit, die man nicht wählen würde.” Dieser musikalische Vollzug unterscheide sich von anderen religiösen Vollzügen “durch eben das Musicking. Nicht nur rezipieren, zuhören, in sich aufnehmen, sondern die Stimme erheben, selbst in Töne fassen, selbst eine Stimme im Tonsatz sein, ein Teil eines Ensembles. Man könnte behaupten, dass Musik ganzheitlicher ist und genau deshalb etwa im Gottesdienst integrale Funktion hat.” Die Predigt sei dann zwar das theologische und liturgische Zentrum eines Gottesdienstes. “Die Verinnerlichung auf allen Ebenen geschieht aber im Musicking.” Unter diesem Begriff könne man den gesamten Gottesdienst fassen, weil er alle Sinne und Dimensionen einbeziehe.
Schneider formulierte dann einige Fragen für die Landeskirche:
- Wie verhalten sich Musik und andere Orte und Zeiten der Glaubenskommunikation zueinander? Welche Verantwortung kommt der Kirche zu?
- Schneider wies auf die zurückgehende musikalische Bildung, Melodie- und Textkenntnisse hin. Die religiöse und musikalische Musikalität müsse ausgebildet werden: “Das ist eine immense Bildungsaufgabe. Wer soll die leisten? Wer kann sie leisten?”
- Schneider fragte, was es für die musikalische Kommunikation des Glaubens brauche. "Mal braucht es eine Orgel, mal eine Probebühne, mal Steckdosen, mal Notenmaterial. Es braucht aber immer Menschen, die kommunizieren”, Gelegenheiten, Räume, Organisation. Wie könne man Gemeinden und Gruppen unterstützen? Welche Arten von Haupt-, Neben- und Ehrenamt brauche man?
- Es stelle sich die Frage: “Wie bekommt man Menschen in Chöre? In Projekte? Das geht wie so oft am besten über lokale Beziehungen. Wenn aber Bindungen und Beziehungen lockerer werden, dann fällt es vor Ort schwerer, dauerhafte Musikangebote vorzuhalten. [...] Wir sind als Kirche und Gemeinde ungemein gefordert, wo immer möglich diese Verbindungen und Bindungen zu fördern. Denn letztlich geht es um die Bindung an Gott.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 20
Landessynode 28 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Situation der Kirchenmusik - Bericht Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke) (PDF)
Landessynode 72 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Response OKR Dr. Schneider) (PDF)
Landessynode 111 KB TOP 20 - Kirche.Voll.Musik - Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik (Zusammenfassungen Stationen Markt der Möglichkeiten - One Pager) (PDF)
Landessynode 580 KB
Abschlussrunde

In einer Abschlussrunde sagte Landespopkantor Urs Bicheler, Innovation entstehe in den Gemeinden in Bands und Musikteams, die es zu fördern gelte. Aber auch bei den großen Chören und Events könne viel entstehen.
Bezirkskantorin Judith Kilsbach betonte die Bedeutung der Musik bei Fusionsprozessen. Kirchenmusik bringe Menschen zusammen. Zumal Kirchenmusik auch nach Kirchenbezirksfusionen weiter in der Fläche in den Gemeinden stattfinde. Auch die Förderung des musikalischen Nachwuchses vor Ort sei deshalb wichtig.
Prof. Thomas Mandl, Rektor der Hochschule für Kirchenmusik (HKM) in Tübingen, erklärte, als landeskirchliche Einrichtung wolle die HKM bedarfsgerecht ausbilden. Dabei habe die Synode viele Impulse gegeben, was auch zum Aufbau des popularmusikalischen Studiengangs geführt habe. Damit sei die HKM deutschlandweit Vorbild. Sollte die vom Oberkirchenrat vorgeschlagene Kürzung in Höhe von 340.000 Euro umgesetzt werden, so Mandl, wäre das wohl mittelfristig das Aus für die Bachelor- und Masterabschlüsse an der HKM und für die HKM selbst. Sie unterliege als staatlich anerkannte Hochschule nämlich der staatlichen Rahmenordnung, für deren Erfüllung die Hochschule schon jetzt an der Untergrenze sei.
Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann betonte in seinem Statement, Posaunenarbeit sei eine „riesige Bildungsarbeit“. Ausbildung und Leitung lägen in vielen Fällen bei Ehrenamtlichen, aber das Ehrenamt brauche ein „Mindestmaß an Hauptamt“. Er appellierte an die Synode zu ermöglichen, was dazu nötig sei.
Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke berichtete, die popularmusikalischen Projektstellen, bei denen viel Innovation entstehe, würden auslaufen. Es müssten neue Orte gefunden werden, an denen Innovation möglich sei. Wenn dies misslinge, gehe die Pluralität und Innovationskraft der Kirchenmusik in der Landeskirche zurück. Mit guter Kirchenmusik habe die Kirche aber große Chancen bei den Menschen: „Wenn wir auf die Kirchenmusik setzen, hat diese Kirche eine gute Zukunft.“
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 21
Popkantorate für je zwei Kirchenbezirke werden nicht eingerichtet

Hellger Koepff, Vorsitzender des Theologischen Ausschusses, berichtete, der Ausschuss habe beschlossen, Antrag 15/20 nicht weiterzuverfolgen. Die Idee des Antrags, für je zwei Kirchenbezirke Stellenanteile für ein popmusikalisches Kantorat bereitzustellen, habe sich als nicht umsetzbar erwiesen. Er verwies jedoch zugleich auf die angestrebte Fortführung der sechs bestehenden 50%-Popkantorate in den nächsten Jahren.
Den vollständigen Bericht zu TOP 21 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 22
Landessynode 49 KB TOP 22 - Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125) (PDF)
Landessynode 10 KB
Entschädigung für Verdienstausfall der Landessynodalen soll begrenzt werden

Die Landessynode hat auf ihrer Frühjahrstagung den vom Geschäftsführenden Ausschuss eingebrachten Gesetzentwurf (Beilage 125) zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuss verwiesen. Der Vorschlag sieht vor, die finanzielle Entschädigung der Landessynodalen auf maximal 250 Euro pro Sitzungstag zu begrenzen.
Andrea Bleher, die stellvertretende Präsidentin der Landessynode, berichtete auf der Frühjahrssynode über die Beratungen des Geschäftsführenden Ausschusses zu den Einsparungen im Budget der Landessynode. Der Ausschuss beschloss, eine Obergrenze für die Entschädigung Landessynodaler einzuführen und einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzubereiten. Dieser sieht vor, das betreffende Kirchliche Gesetz um die Wörter „bis zu einem Höchstbetrag von 250 Euro pro Tag“ zu ergänzen.
Bleher machte deutlich, dass die Änderung die Höhe des Verdienstausfalls konkretisiere und damit auch die sinkenden Budgets von Landeskirche und Landessynode berücksichtigt werden. Das Gesetz solle am 1. Februar 2026 in Kraft treten.
Diesen Gesetzentwurf (Beilage 125) brachte Bleher zur Aussprache und Verweisung an den Rechtsauschuss ein. Der ausführliche Bericht soll während der Sommersynode vorgestellt werden.
Beschluss
Ohne Aussprache hat die Synode mit Mehrheit bei zwei Gegenstimmen, einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme beschlossen, den Gesetzentwurf zur Begrenzung des Verdienstausfalls von Landessynodalen (Beilage 125) zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuss zu verweisen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 22 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 23
Kirchliche Trauung: Neues Gesetz für mehr Gleichheit

Die Landessynode beriet über eine Reform der kirchlichen Trauung. Gleichgeschlechtliche Paare sollen gemäß dem Vorschlag künftig in allen Gemeinden getraut werden können, sofern keine örtliche Regelung dagegensteht. Nach diesem Entwurf soll eine einheitliche Agende eingeführt werden, das Gewissensschutzrecht soll bestehen bleiben. Der Entwurf geht in die Ausschüsse.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch., Leiter des Rechtsdezernats, berichtete, mit dem neuen Gesetzentwurf zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung solle eine Entwicklung fortgesetzt werden, die bereits 2019 mit der Einführung gottesdienstlicher Formen für gleichgeschlechtliche Paare begonnen habe. Der aktuelle Entwurf ziele auf eine klare Gleichstellung: Künftig sollen Trauungen gleichgeschlechtlicher Ehepaare sowie von Paaren mit nichtbinärer Geschlechtsidentität grundsätzlich in allen Kirchengemeinden möglich sein.
Dabei werde, so Frisch, die bisherige Unterscheidung zwischen „kirchlicher Trauung“ und „Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung“ aufgehoben. Alle Eheschließungen würden liturgisch als kirchliche Trauung behandelt. Die Trauagende werde landeskirchlich einheitlich geregelt; die Begrenzung auf ein Viertel der Gemeinden und die Revisionsklausel sollen entfallen.
Ein neues Opt-out-Verfahren solle nach diesem Entwurf das bisherige Opt-in Verfahren ersetzen: Gemeinden, die keine gleichgeschlechtlichen Trauungen durchführen möchten, müssten dies aktiv in ihrer Gottesdienstordnung festlegen. Damit solle der Kritik am bisherigen Verfahren begegnet werden.
Wichtig bleibt der Schutz der Gewissensfreiheit: Niemand sei nach diesem Entwurf verpflichtet, eine solche Trauung zu leiten oder daran mitzuwirken. Neu hinzu kommen solle ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot.
Der Entwurf versteht sich laut Dr. Michael Frisch als evolutionäre Weiterentwicklung – mit dem Ziel, Differenz zu respektieren und zugleich die Einheit der Kirche zu wahren. Die Verweisung an den Rechts- und Theologischen Ausschuss werde empfohlen.
Hinweis: Die Aussprache zu TOP 23 fand gemeinsam mit der zu TOP 10 statt.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 24
Ehrenamtskirche soll erprobt werden
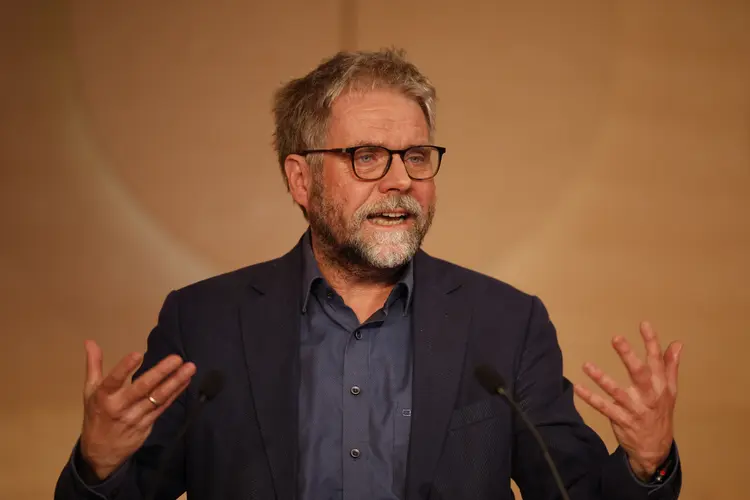
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete, der Rechtsausschuss habe TOP 24 und TOP 25 gemeinsam behandelt, da beide Anträge eng miteinander verbunden seien. Der Antrag hat zum Ziel, bis zu 10 kleinen Kirchengemeinden im Rahmen einer Erprobung die Leitung und Geschäftsführung ohne geschäftsführende Pfarrperson zu ermöglichen.
Beschluss
Die Landessynode hat mit Mehrheit beschlossen, den Oberkirchenrat zu bitten, Antrag 15/23 umzusetzen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 24 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Hinweis: Die Aussprache zu TOP 24 fand gemeinsam mit der zu TOP 25 statt.
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzender von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
1. und 2. Vorsitz im KGR für Ehrenamtliche soll ermöglicht werden

Die Landessynode stimmte nach einer ausführlichen Aussprache für die Erarbeitung eines Gesetzentwurfes zur Änderung der Kirchengemeindeordnung, durch den Oberkirchenrat, damit der/die 1. und der/die 2. Vorsitz von gewählten bzw. zugewählten Mitgliedern des Kirchengemeinderats wahrgenommen werden kann.
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete, der Rechtsausschuss habe TOP 24 und TOP 25 gemeinsam behandelt, da beide Anträge eng miteinander verbunden seien.
Während der Beratung sei festgestellt worden, so Plümicke, dass die Vorsitze des Kirchengemeinderats von zwei Ehrenamtlichen wahrgenommen werden könnten und weiterhin in jeder Kirchengemeinde mindestens eine Pfarrperson mit der Leitung der Gemeinde betraut sei (§ 16 Absatz 1, Satz 1 „Kirchengemeinderat und Pfarrerinnen und Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde.“ bliebe somit unberührt.
Der Rechtsausschuss habe eine Weiterverfolgung des Antrags befürwortet. Daher empfehle er dem Plenum zu beschließen, den Oberkirchenrat zu bitten, einen Gesetzentwurf zur Änderung der Kirchengemeindeordnung zu erarbeiten, so dass es möglich werde, dass der/die 1. und der/die 2. Vorsitz von gewählten bzw. zugewählten Mitgliedern des Kirchengemeinderats wahrgenommen werden könnten.
Gemeinsame Aussprache zu den TOPs 24 und 25
In der Tagesordnung war zunächst keine Aussprache zu TOP 24 vorgesehen. Diese wurde jedoch vor Aufruf des TOP 24 durch einen Antrag zur Geschäftsordnung eingeleitet.
Matthias Hanßmann (Horb a. N.) sagte, es seien in den letzten Jahren Strukturen geschaffen worden, die die Arbeit vor Ort flexibel werden ließen. Beide Anträge zielten darauf ab, Gemeinden, Alternativen zur Fusion, einer Gesamtkirchengemeinde oder Verbundkirchengemeinde aufzuzeigen. Antrag 15/23 ziele darauf ab, gemeinsam zu überlegen, wie eine solche Ehrenamtskirche ohne theologische Leitung geregelt werden könne. Hanßmann betonte, dass es sich hier um eine Erprobung handele und er es für ein wichtiges Signal in der Spardebatte halte, an dieser Stelle flexibel zu sein.
Kai Münzing (Dettingen an der Erms) sagte, die Zukunft der Kirche sei eine Ehrenamtskirche. Zudem befinde sich die Kirche in einem großen Transformationsprozess und Dinge müssten ausprobiert werden. Deshalb spreche er sich für die Ermöglichung eines Erprobungsraums aus, um diese testen zu können. Er gab zudem zu bedenken, das Ehrenamt nicht zu unterschätzen.
Dr. Thomas Gerold wies darauf hin, dass eine Ehrenamtskirche sicher kein Massenphänomen werden würde. Sie sei für kleinere Gemeinden mit hohem Ehrenamtsengagement sinnvoll. Solche Modelle gäbe es laut Gerold bereits außerhalb der Landeskirchen. Diesen merke man jedoch, an, dass die Anbindung an eine größere Kirche fehlen. Er plädiere für die Ermöglichung einer Erprobung innerhalb unserer Landeskirche.
Holger Stähle (Schwäbisch Hall) berichtete, dass seine Gemeinde von diesen Überlegungen konkret betroffen sei. Nach seinem Weggang würde diese gemäß Pfarrplan 2030 von einer Pfarrperson aus der übernächsten Gemeinde mitversorgt werden. In diesem Fall wäre eine Entlastung der Pfarrperson im Bereich der Geschäftsführung wünschenswert. Das Argument der Verlässlichkeit der verbeamteten Pfarrpersonen sei seiner Meinung nicht haltbar. Ehrenamtliche seien genauso oder teilweise sogar verlässlicher.
Ute Meyer (Renningen) warb dafür, Hoffnung zu haben, dass die Ehrenamtskirche ein kleiner Baustein sein könnte, wie es mit der Kirche weiter gehen könne.
Matthias Böhler (Besigheim) nannte das Beispiel eines größeren Sportvereins, der durch Ehrenamtliche geleitet werde. Er fragte, weshalb man kein Zutrauen in die Ehrenamtlichen habe. Die Landeskirche sei eine Amtskirche, die ihre Gemeinden von oben nach unten verlässlich versorge. Dieses Kirchenbild wolle er jedoch verändern durch den Bau der Gemeinde von unten. Auch er erlebe verlässliche Ehrenamtliche mit hohem Verantwortungsbewusstsein. Die Landeskirche solle in dieser Hinsicht risikofreudiger werden.
Eckart Schulz-Berg (Stuttgart) betonte, er verstehe die praktischen Gründe der Anträge. Er halte jedoch das Duett von einer theologischen Person und einer nicht theologischen Person in der Leitung nicht nur für geistlich sehr wertvoll, “beides befruchte sich auch gegenseitig”. Das gehöre zur Substanz der Landeskirche. Zudem warnte er vor möglichen Streitigkeiten, wenn das theologische Element in der Leitung fehle.
Zwischenruf: Matthias Hanßmann (Horb a. N.) betonte noch einmal den Charakter der Erprobung. Hier sollten genau solche Fragestellen, wie etwa das theologische Gegenüber, erörtert werden.
Heidi Hafner (Sindelfingen) berichtete, dass sie Gemeinden kenne, in denen es enorme Probleme durch Ehrenamtliche in der Leitung gebe. Sie sei sich nicht sicher, wie eine Qualitätssicherung in einer Ehrenamtskirche möglich sei. Dies wäre eine große Herausforderung, auch für den Oberkirchenrat.
Zwischenruf: Matthias Böhler (Besigheim) warf ein, dass auch Pfarrpersonen Fehler machen würden und es in einem solchen Fall Regelungen gebe. Diese könnten auch auf Ehrenamtliche übertragen werden. Ehrenamtliche würden auch Kompetenzen einbringen. Dies sei eine große Chance.
Andrea Bleher (Untermünkheim) meinte, sie könne die Bedenken und Einwände des Oberkirchenrats bezüglich der Rechtssicherheit sehr gut verstehen. Rechtssicherheit bestehe jedoch auch in Vereinen mit ehrenamtlicher Leitung. Sie führte auf, dass Ehrenamtliche ebenfalls sehr verlässlich seien, dass man Sand im Getriebe auch durch Regelungen nicht verhindern könne und das Duett Laie und Theologe wichtig sei. Durch die Pfarrpläne werden die Gemeinden größer, wodurch sich auch die Fülle der Arbeit der Pfarrpersonen vergrößere. Kleinere Einheiten könnten durch andere strukturelle Formen erhalten bleiben. Daher befürworte sie beide Anträge.
Jörg Beurer (Heilbronn) warf die Frage auf, was das Zukunftsbild der Kirche sei. Wir werden weniger und die Einheiten seien klein. Die Beheimatung von Menschen geschehe, nicht in einer Region, sondern in einer konkreten Gemeinschaft vor Ort. Dies sei sein Gemeindebild. Hier könne die Gemeinde auch kleiner sein, als es in einem Verteilschlüssel gerechnet würde. Daher sei die Öffnung von Erprobungsräumen wichtig. Man müsse jedoch die dahinter liegende größere Frage stellen, ob nicht neue Formen in der Auftrennung Kirchengemeinde und Körperschaft des öffentlichen Rechts nötig seien. Die alte Struktur halte er nicht für zukunftsfähig.
Annette Rösch (Wannweil) sagte, durch die Umwandlungsmaßnahmen stärke man bereits die Regionalverwaltungen, wodurch vieles an die Verwaltungsebene abgegeben werde und so Pfarrpersonen bereits entlastet werden. Natürlich wünsche man sich qualifizierte Theologen und Theologinnen in der Gemeindeleitung. Aber es werde immer schwerer, in kleinen Gemeinden etwa im ländlichen Raum Pfarrerinnen und Pfarrer zu finden. Dort solle Kirche aber nicht enden, dort vertraue sie auch auf das Ehrenamt.
Christoph Reith (Winterbach) betonte, dass es sich hier „nur“ um eine Erprobung handele. Junge Menschen seien anders engagiert und lebten in andere Lebenswelten, die vielleicht nicht verstanden werden. Eine Ehrenamtskirche entspräche diesen möglicherweise mehr. Er wünsche sich an dieser Stelle mehr Mut, etwas Neues zu erproben.
Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) gab zu bedenken, dass mit den Fusionsgemeinden Größen erzeugt werden würden, die für Gemeindeglieder nicht mehr zu überblicken seien. In kleinen Einheiten müsse jedoch das Ehrenamt, dessen Engagement immer größer werde, gestärkt werden. Man stehe mit der Idee am Anfang und müsse ausloten, was sinnvoll sei, um so zu guten Lösungen zu kommen.
Gerhard Keitel (Maulbronn) schlug vor, von den Ältestenkreisen in der Badischen Landeskirche zu lernen und sogar noch einen Schritt weiterzugehen. Die kleinen Herzensorte sollten gestärkt werden und der Kirchengemeinderat sollte mehrere dieser Orte zusammenschließen und wichtige Rechtssätze festlegen.
Prof. Dr. J. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) kritisierte den Begriff Ehrenamtskirche. Die Überhöhung der pfarramtlichen Kompetenz und der Konfliktregelungskompetenz halte er für schwierig. Er berichtete über das EJW, in dem teilweise Ehrenamtliche über Hauptamtlichen sitzen würden. Deshalb fordere er Erprobungsräume.
Matthias Vosseler (Stuttgart) schlug vor, mit anderen, bei denen es bereist ehrenamtliche Modelle gebe, wie der Schweiz oder Baden, in den Austausch zu treten. Wenn die Synode Vorbild werden wolle, sollte es auch hier mehr ehrenamtliche Mitglieder des Gremiums geben. Dies sei ein wichtiges Signal.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch (Leiter des Rechtsdezernats) sprach in einer Stellungnahme zu den beiden TOPs 24 und 25. Frisch sprach zunächst zu Antrag 26/23 (TOP 25). Er wies auf die Möglichkeiten des geltenden Rechts hin:
- Mitglieder des Kirchengemeinderats (KGR) könnten verschiedene Aufgaben übernehmen, aber nicht Kompetenzen, die den beiden Vorsitzenden zugeordnet seien, zum Beispiel die gerichtliche Vertretung, das Widerspruchsrecht gegen ordnungswidrige KGR-Beschlüsse und das Eilentscheidungsrecht.
- Auch wenn inhaltliche Aufgaben der geschäftsführenden (im Folgenden gf.) Pfarrperson einem anderen übertragen würden, bleibe eine Letztverantwortung bei der gf. Pfarrperson. So könne sie etwa die Einberufung des KGR erzwingen, auch wenn sie nicht den 1. Vorsitz habe.
Die im Antrag angestrebte Lösung ersetze diese Letztverantwortung und die einvernehmliche Verteilung von Aufgaben durch das Entscheidungsrecht des KGR. Der Vorsitz im KGR solle nicht mehr kraft Amtes mit einer Pfarrperson verbunden sein.
Hindernisse:
- Der Dienstauftrag einer Pfarrperson werde durch den Oberkirchenrat festgelegt. Der Kirchengemeinderat könne den Dienstauftrag nicht festlegen. Dies erstrebe jedoch der Antrag teilweise, wenn der Vorsitz nicht Kraft Amtes sondern aufgrund einer Wahlentscheidung wahrgenommen werden soll. Das wäre mit der Dienstherreneigenschaft der Landeskirche nur schwer vereinbar.
- Auch der Entzug der Geschäftsführung im Rahmen eines Disziplinarverfahrens sei dem Dienstherren vorbehalten. Künftig wäre das nach diesem Antrag durch Wahl des KGR möglich.
- Seelsorgegeheimnis: Schriftstücke für die Kirchengemeinde hat die gf. Pfarrperson oder eine Vertretung im Pfarramt in Empfang zu nehmen. Damit werde das Seelsorgegeheimnis gewahrt.
- Besoldung: Für die Besoldung sei die Geschäftsführung ein Faktor. Die Einstufung sei aber nur mit großem Aufwand bei wechselnden Wahlentscheidungen des KGR möglich. Zudem könne die GF nur entfallen, wenn zuvor die Kriterien für die Bewertung der Pfarrstelle geändert würden.
- Komplexität und Regelungsbedarf würden in vielen Bereichen stark steigen, die die gf. Pfarrperson voraussetzen. Die angestrebte Variabilität führe dauerhaft zu höherem Verwaltungsaufwand und komplexeren Strukturen.
Grundsätzliche Bedenken: Leitung in der Landeskirche erfolge auf allen Ebenen geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit. Dies sei auch dadurch verwirklicht, dass die gf. Pfarrperson den 1. Vorsitz im KGR und Letztverantwortung habe. Die betreffe auch Bereiche wie KGR-Beschlüsse zur Gottesdienstordnung, für deren Beurteilungen Pfarrpersonen wegen ihrer theologischen Ausbildung kompetent seien. Aus diesen Gründen empfehle der Oberkirchenrat, Antrag 26/23 nicht zuzustimmen.
Zu Antrag 15/23 sprach Frisch kürzer, da die genannten Argumente hierfür ebenso gelten würden. Dieser Antrag sei inhaltlich weitreichender, da es dabei nicht um den Vorsitz im KGR gehe, sondern generell um die Kirchengemeinde ohne Pfarrperson. Frisch ergänzte folgende Aspekte:
Professionen wie die des Pfarrberufs, der Medizin oder des Richteramts hätten bislang das Hauptamt durch das Ehrenamt allenfalls ergänzt, aber nicht ersetzt. Die Professionalität des Pfarrberufs sei durch diesen Antrag ernsthaft gefährdet. Der Oberkirchenrat könne dem Antrag im Moment gar nicht entsprechen, da Strukturerprobungen aufgrund des von der Landessynode beschlossenen Strukturerprobungsgesetzes momentan nicht möglich seien. Dazu müsste zunächst dieses Gesetz geändert werden. Aus diesen Gründen empfehle der Oberkirchenrat, Antrag 15/23 nicht zuzustimmen.
Zwischenruf: Thomas Stuhrmann (Abstatt) sagte, er verstehe die Ausführungen von Dr. Frisch, jedoch bringen genau diese komplizierten Vorgänge hochengagierte Ehrenamtliche dazu in Freikirchen abzuwandern.
Erstantragsteller Matthias Hanßmann (Horb a. N.) sagte, Antrag Nr. 15/23 sei eine Willensbekundung. Wenn diese rechtlich nicht möglich sei, sei das dann ein Teil dessen, was geändert werden müsse. Man handele hier nicht leichtfertig. Daher handele es sich auch um einen Antrag auf Erprobung. Er empfehle die Beschlussfassung zu beiden Anträgen.
Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, griff Themen der Debatte auf: Es sei etwa schade, wenn es in einem Dorf einen Ortschaftsrat gebe, der kein kirchliches Gremium als Gegenüber mehr habe. Oder wenn ein Pfarrer oder eine Pfarrerin vier Gemeinden in einer Verbundkirchengemeinde habe, dann wolle er oder sie nicht auch noch in vier Kirchengemeinderäten präsent sein. Hier wäre es hilfreich, wenn Ehrenamtliche solche Teilgemeinden leiten könnten. Realistisch vorstellbar sei das Ganze nur bei kleinen Gemeinden. Plümicke stellte klar, diese Möglichkeit solle nicht grundsätzlich eingeführt werden, sondern nur als eine Möglichkeit. Der Regelfall solle weiterhin die Kombination aus einer Pfarrerin oder einem Pfarrer und einem oder einer Ehrenamtlichen sein.
Beschluss
Antrag 26/23 wurde mit großer Mehrheit angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 25 finden Sie in der Klappbox oben “Dokumente zum Tagesordnungspunkt”
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 26 Selbstständige Anträge
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 26
Landessynode 48 KB TOP 26 - Selbstständige Anträge (Antrag Nr. 04-25 - Änderung Förderpraxis Ausgleichsstock PV-Anlagen und Batteriespeicher) (PDF)
Landessynode 62 KB TOP 26 - Selbstständige Anträge (Antrag Nr. 06-25 - Interreligöse Jugendarbeit - Religiös sprachfähig werden im Dialog) (PDF)
Landessynode 56 KB TOP 26 - Selbstständige Anträge (Antrag Nr. 07-25 - Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR) (PDF)
Landessynode 63 KB TOP 26 - Selbstständige Anträge (Antrag Nr. 08-25 - Aufarbeitung der Coronazeit und Förderung von Versöhnungsprozessen) (PDF)
Landessynode 57 KB
Selbständige Anträge
- Antrag Nr. 01/25: Beschleunigung und Vereinfachung bei Neuanstellungen von kirchlichen Mitarbeitenden - an den Rechtsausschuss verwiesen
- Antrag Nr. 04/25: Änderung Förderpraxis Ausgleichsstock PV-Anlagen und Batteriespeicher - an den Finanzausschuss verwiesen
- Antrag Nr. 06/25: Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog - an den Ausschuss für Bildung und Jugend verwiesen
- Antrag Nr. 07/25: Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR - an den Ausschuss für Kirche und Gemeindeentwicklung verwiesen
- Antrag Nr. 08/25: Aufarbeitung der Coronazeit und Förderung von Versöhnungsprozessen - an den Ausschuss für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung verwiesen
Die vollständigen Antragstexte zu TOP 26 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 27 Förmliche Anfragen
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Förmliche Anfrage Nr. 51/16: zum Sachstand zur Einrichtung des Runden Tisches Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherbildung

Oberkirchenrat Christian Schuler, Leiter des Dezernats für Gemeinde, Umwelt und Immobilienwirtschaft, beantwortet die Anfrage mit Hinweisen auf bereits erfolgte Maßnahmen und Verzögerungen bei der Organisation des Runden Tisches. Mit der Einrichtung der Webseiten www.beschaffung.elk-wue.de, www.erntedank-heute.de und www.dEATer.info seien einige Anliegen des genannten Antrages aufgenommen worden. Aus Gesprächen mit dem Evangelischen Bauernwerk bezüglich der Durchführung des angesprochenen Runden Tisches Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherbildung seien verschiedene Veranstaltungen entstanden. Die Einberufung des Runden Tisches an sich verzögere sich jedoch aufgrund grundsätzlicher konzeptioneller Überlegungen zum Bauernwerk. Prälat Ralf Albrecht werde jedoch in Absprache mit synodalen Vertretern und Vertreterinnen den weiteren Zeitplan ausarbeiten.
Den vollständigen Bericht zu TOP 27 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 28
Bestandsaufnahme der landeskirchlichen Ukraine-Hilfe

Nach drei Jahren Krieg in der Ukraine zog der Vorsitzende der Ukraine-Koordinations-Gruppe, Klaus Rieth, auf der Frühjahrssynode eine Bilanz der landeskirchlichen Ukraine-Hilfe. Ein zentraler Punkt war, Dank zu sagen – vor allem an die vielen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz in den württembergischen Kirchengemeinden.
Klaus Rieth berichtete auf der Frühjahrssynode über die Ukraine-Hilfe der Landeskirche seit März 2022. Dabei bezifferte er die finanzielle Unterstützung auf 750.000 Euro, die die Landeskirche seither aufgebracht habe. Rieth betonte, dass die württembergische Landeskirche die Landeskirche war, die am schnellsten und konkretesten auf die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten reagiert habe. Im Anschluss ging er detailliert auf die Verwendung der finanziellen Mittel ein und forderte zugleich dazu auf, in der Spendenbereitschaft nicht nachzulassen.
Rieth bedankte sich bei der Diakonie Württemberg und dem Gustav-Adolf-Werk (GAW) für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Dabei wies er auf konkrete Spendenmöglichkeiten hin und hob die mehr als 40 Transporte mit Hilfsgütern in die Ukraine hervor. Abschließend dankte er der Synode, dem Oberkirchenrat und ganz besonders den vielen Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden für ihren Einsatz zugunsten der ukrainischen Geflüchteten in Württemberg. Diese Arbeit, so Rieth, sei vielfach von lokalen und regionalen Medien aufgegriffen worden und habe sich damit positiv auf das Image der Landeskirche ausgewirkt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 28 finden Sie in der Klappbox oben “Dokumente zum Tagesordnungspunkt”
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Strategische Planung der Kinder- und Jugendarbeit

Dekan i.R. Siegfried Jahn, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Jugend berichtete, der Ausschuss habe mehrheitlich beschlossen, den Antrag zur strategischen Planung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in den Jahren 2025/2026 nicht weiterzuverfolgen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 29 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 30
Familienarbeit neu vernetzt

Dekan i.R. Siegfried Jahn, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Jugend, berichtete, der Ausschuss habe einstimmig beschlossen, den Antrag Nr. 16/20 nicht weiter zu verfolgen. Thema war die Weiterentwicklung der landeskirchlichen Familienarbeit im Zuge neuer strategischer Schwerpunktsetzungen und Strukturveränderungen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 30 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht
TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Alle Themen der Tagung
Im Überblick:
- Landessynode kompakt - Hauptthemen der Frühjahrstagung
- Synodalpräsidentin Foth: 5 Themen, 5 Antworten (Video)
- Übersicht: Das hat die Landessynode beschlossen
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente
- Gottesdienst
- Grußworte
- TOP 01 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechnungsprüfamtgesetzes
- TOP 02 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Taufordnung
- TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes
- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Pfarrerversorgungsgesetzes und des Kirchenbeamtenbesoldungs- und versorgungsgesetzes (Beilage 129)
- TOP 05 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 126)
- Begrüßung der Mitglieder der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK) im Verbund Württemberg
- TOP 06 Eckwerte zur mittelfristigen Finanzplanung 2025-2029
- TOP 07 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie
- TOP 08 Aktuelle Stunde
- TOP 09 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt unter veränderten Bedingungen
- TOP 10 Ergänzung des Gottesdienstbuchs, Zweiter Teil, Teilband Die kirchliche Trauung, um die Trauung, um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang
- TOP 11 Ermöglichung der Weiterführung von elkw-Adressen im Ruhestand
- TOP 12 Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 13 Fortsetzung des Programms „Ehrenamtliche feiern Andacht“
- TOP 14 Unterstützung im Pfarramt durch emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 15 Weitere Flexibilisierung von Teilzeitregelungen und der Residenzpflicht
- TOP 16 Arbeitszeitregelung für Pfarrerinnen und Pfarrer
- TOP 17 Polizeiliches Führungszeugnis
- TOP 18 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg
- TOP 19 Änderung der Zusammensetzung des Vorstands der Ev. Seminarstiftung
- TOP 20 Kirche.Voll.Musik – Schwerpunkthalbtag Kirchenmusik
- TOP 21 Förderung lokaler Musikteams über den Landeskirchenmusikplan
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127)
- TOP 24 Erprobung einer "Ehrenamtskirche" im Rahmen des PfarrPlans 2030
- TOP 25 Ermöglichung beider Vorsitzende*n von Kirchengemeinden durch zugewählte Mitglieder
- TOP 26 Selbstständige Anträge
- TOP 27 Förmliche Anfragen
- TOP 28 Bericht über die Ukrainehilfe
- TOP 29 Perspektiven und Maßnahmen der Strategischen Planung zur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- TOP 30 Kompetenzzentrum Familie
- TOP 31 Konfirmation bei Nichtteilnahme am Religionsunterricht
Dokumente zu Tagesordnungspunkt TOP 31
Für die Konfirmation bleibt Besuch des Religionsunterrichts notwendig

Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete, der Ausschuss habe beschlossen, Antrag 14/24 nicht weiterzuverfolgen. Dieser Antrag wollte erreichen, dass Jugendliche auch dann konfirmiert werden können, wenn sie aus gewichtigen, persönlichen Gründen nicht am schulischen Religionsunterricht teilnehmen können. Plümicke begründete die Entscheidung des Ausschusses damit, dass durch diese Änderung die Bedeutung des Religionsunterrichts in der Argumentation gegenüber dem Staat reduziert würde.
Den vollständigen Bericht zu TOP 31 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".
Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht