29.09.2016
„Den Himmel erden, die Erde himmeln“
Zwei Jahre Zentrum Diakonat in Ludwigsburg
Religionsunterricht, Suchtberatung, Arbeit mit Flüchtlingen, Jugend- und Seniorenarbeit: Diakoninnen und Diakone nehmen in Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen ganz verschiedene Aufgaben wahr. Um den Diakonat zu stärken, hat vor zwei Jahren hat das Zentrum Diakonat in Ludwigsburg seine Arbeit aufgenommen. Ute Dilg hat mit dem Leiter, Kirchenrat Joachim L. Beck, gesprochen.
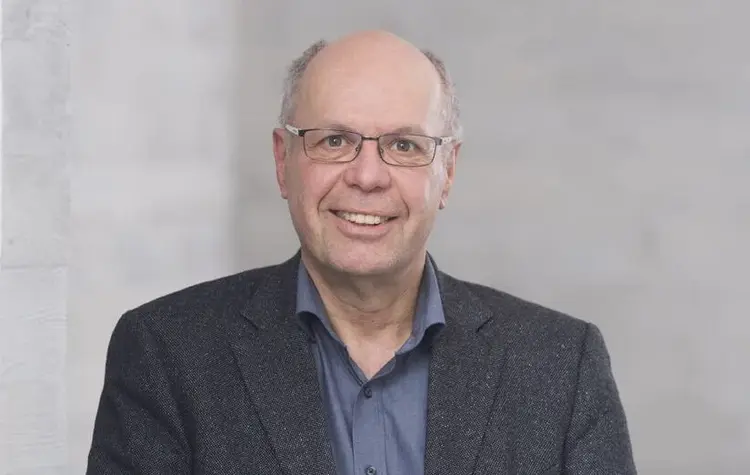
Warum braucht die evangelische Landeskirche Diakoninnen und Diakone?
Diakoninnen und Diakone haben die gesellschaftlichen Herausforderungen in ihrer Gemeinde oder sozialen Einrichtung, in ihrem Quartier und in ihrer Region im Blick. Das ist ihr kirchlicher Auftrag. Sie leben und gestalten in ihrer Arbeit die diakonische Dimension der Kirche. Ganz konkret wurde das in den letzten Monaten in der Arbeit mit Flüchtlingen erkennbar. Ich kann auch die Verbindung von Schule und Jugendarbeit nennen oder die Frage: Wie werden diejenigen begleitet und gestärkt, die an Demenz erkrankte Angehörige betreuen? So wird Evangelium erlebbar und konkret. Diakonie ist ein Kernbestandteil der Kirche. Deshalb wollen wir den Diakonat stärken.
Warum sind gerade Diakoninnen und Diakone prädestiniert für diese Aufgabe?
Diakoninnen und Diakone haben eine Doppelqualifikation: eine sozialwissenschaftliche Ausbildung und theologische Reflexionsfähigkeit. Zum Beispiel haben sie an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg Soziale Arbeit und Diakoniewissenschaften oder Religionspädagogik studiert. Das führt dazu, dass sie „mit zwei Brillen“ auf Situationen schauen, einer theologischen und einer sozialwissenschaftlichen. Das ist eine große Stärke, die Diakoninnen und Diakonie in den verschiedensten Arbeitsbereichen einbringen können. Etwa in Kirchengemeinden, in der Schüler- und Jugendarbeit, im Religionsunterricht, in diakonischen Einrichtungen wie Altenhilfe oder Pflege.
Sie leiten das Zentrum Diakonat, das nach einem Beschluss der Landessynode vor zwei Jahren gegründet wurde. Was sind Ihre Aufgaben?
Wir haben genau diese diakonische Dimension von Kirche im Blick und versuchen daran konzeptionell weiterzudenken. Das hört sich jetzt ziemlich theoretisch an, ist es aber gar nicht. Im Grunde geht es darum, immer wieder zu schauen, welche Rolle die Diakoninnen und Diakone in Kirche und Diakonie spielen. Eine weitere Aufgabe ist, die Aufbauausbildung und die berufsbegleitende Qualifizierung durchzuführen. Also das weiterzuführen, was bisher von der Stiftung Karlshöhe getan wurde und das nun bei uns angesiedelt ist. Außerdem beraten und unterstützen wir die Anstellungsträger, also Gemeinden und diakonische Einrichtungen, sowie die Diakoninnen und Diakone selbst.
Für das Zentrum wurden ja Arbeitsbereiche aus anderen Einrichtungen an den neuen Standort nach Ludwigsburg verlegt. Wie hat das funktioniert? Gab es Widerstände?
Ich würde es Irritationen nennen. Überall, wo Aufgaben neu verteilt werden, müssen die Akteure das miteinander abstimmen. Andererseits war die Gründung des Zentrums Diakonat ein deutliches Signal der Landeskirche: Diakone sind für Kirche und Diakonie wichtig, die Landeskirche übernimmt selbst die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung und die Weiterentwicklung des Diakonats. Wenn Sie so wollen, kann man das auch als Aufwertung des Berufsstandes der Diakonin und des Diakons werten.
Was sind derzeit wichtige Themen, mit denen Sie und Ihr Team sich beschäftigen?
Wir überlegen gerade, welche Kompetenzen Diakoninnen in den verschiedenen Feldern benötigen und wie diese in die Fortbildungen einfließen müssen. Etwa in die zweijährige berufsbegleitende Qualifizierung, die sich an Menschen richtet, die in diakonischen Einrichtungen in der mittleren Führungsebene arbeiten und sich weiterbilden wollen zum Diakon. Es geht also viel um Inhalte der Ausbildung und wie wir sie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des nächsten Jahrgangs anpassen können. Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, Kirchenbezirke zu unterstützen, wenn „Diakonatspläne“ entwickelt werden, quasi analog zu und am besten in Verbindung mit Pfarrplänen. Wir beraten die Kirchenbezirke dabei, zu überlegen, wo Diakoninnen und Diakone in ihrem Bezirk sinnvoll eingesetzt werden können. Zum Beispiel in der Arbeit mit Ehrenamtlichen, in der Kooperation mit Vereinen, der Arbeit mit den „jungen Alten“ oder Schulsozialarbeit. Diese Vorschläge werden dann den jeweiligen Bezirkssynoden unterbreitet. Leitfragen dabei sind: Was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen? Wo ist Kirche und Diakonie gefragt? Wie sind die Gemeinden im Gemeinwesen eingebunden? Wo braucht es die Doppelqualifikation der Diakoninnen und Diakone.
Wie soll der Diakonat in 20 Jahren aussehen?
Meine Vorstellung ist, dass multiprofessionelle Teams in Kirchengemeinden arbeiten. Sie bestehen aus Pfarrern, Diakonen, Kirchenmusikern, Erziehern, Religionslehrern, Mesnern und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Menschen überlegen gemeinsam mit den verantwortlichen Gremien, zum Beispiel dem Kirchengemeinderat, welche Herausforderungen in ihren Kirchengemeinden sowie in ihrer Region zu meistern sind. In diesem Team spielen Diakoninnen und Diakone eine wichtige Rolle. Es gibt einen wunderbaren Spruch dazu: „Die Aufgabe eines Diakons ist, den Himmel zu erden und die Erde zu himmeln.“