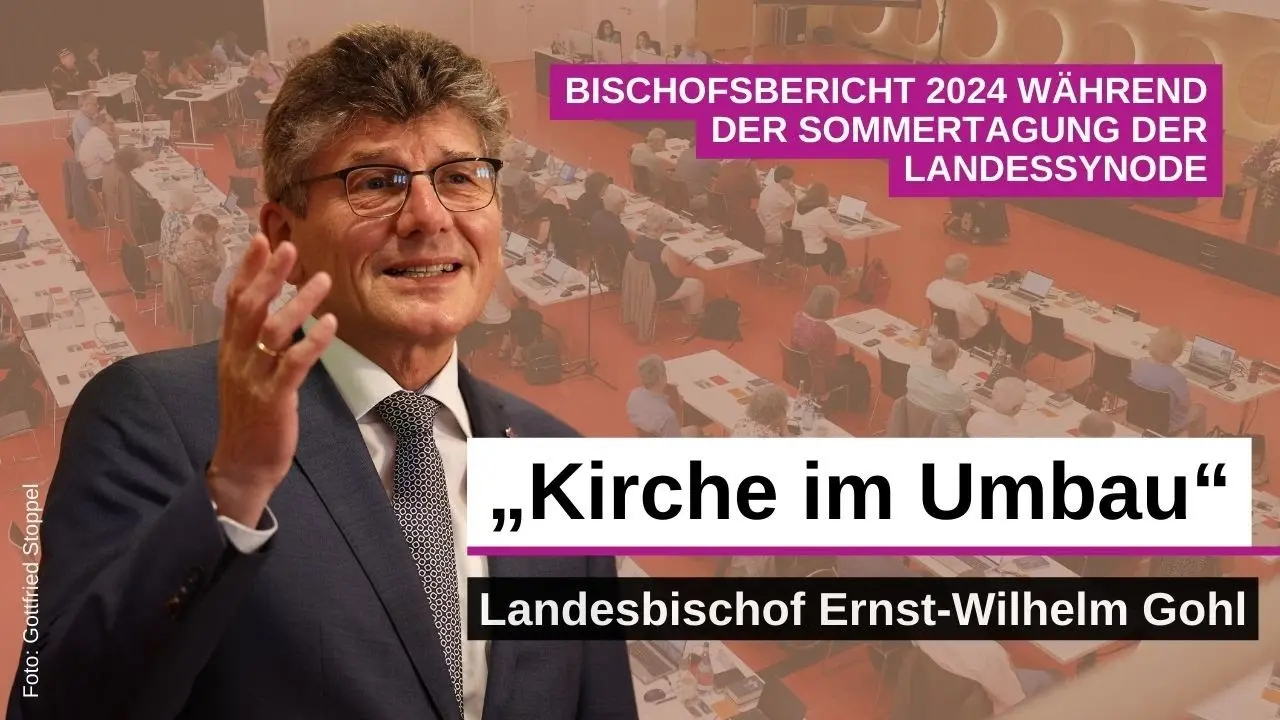28.06.2024
Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl: "Kirche im Umbau"
Bischofsbericht vor der Landessynode
Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sprach im Rahmen der Sommertagung der Landessynode über die tiefgreifenden Veränderungen und Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft. Themen in Landesbischof Gohls Bericht waren unter anderem: Die Veränderungen in der Kirche, der Ukraine-Krieg, die ForuM-Studie, der Nahost-Konflikt, das Anwachsen der politischen Rechten und die Diskussion über die Reform des Paragrafen 218.
Den Volltext des Bischofsberichts finden Sie hier als PDF zum Download.
Kirche im Umbau
Gohl sagte, Verunsicherung und Überforderung angesichts vielfältiger Umbauprozesse in der Landeskirche müsse sich äußern können und lasse sich nicht „mit Beschwichtigungen und einfachen Rezepten beiseite wischen“. Allein der Begriff Transformation sei für viele schon ein Reizwort. Ihm gehe es dabei um „eine Haltung, die auf dem gemeinsamen Grund, Jesus Christus, beieinanderbleiben will. Das heißt: Miteinander bei den kontroversen Themen im Gespräch bleiben und Lösungen suchen: in den Gemeinden, mit der Landessynode, mit dem Oberkirchenrat, mit Menschen aus dem Quartier, dem Nachbardorf oder in den einzelnen Brennpunkten der großen Städte.“ Transformation meine „nicht Abbruch, sondern Umgestaltung. Auch die Chance, Lasten abzulegen, Neues zu entdecken und auszuprobieren“. Beispielhaft hob Gohl den Innovationstag vom Mai in Reutlingen hervor mit seiner „spürbaren Aufbruchstimmung“.
Explizit ging Gohl auf die aktuelle intensive Diskussion über den Sonntagmorgengottesdienst ein. Manche Menschen forderten, diesen ganz aufzugeben. Er halte dies jedoch für problematisch. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen sei „Träger christlicher Kultur und er bietet einen verlässlichen Ort für die unterschiedlichen Milieus und Gruppen“. Mit ihm würde „öffentliches und damit sichtbares Christentum verloren gehen.“ Ein zweiter Grund liege in der theologischen Bedeutung des Gottesdienstes: „Durch Gottes Wort angesprochen versammelt sich die Gemeinde zum Gottesdienst. Durch das Hören des Wortes wird sie gebildet. Gemeinde ist nur, weil Gottes Wort diese Gemeinde schafft, ruft, versammelt, ermutigt und sendet.“
Für sein Bild von der Kirche der Zukunft bezog Gohl sich auf das Bild von „Kirche als Herberge der Mündigkeit“, das die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Kristin Jahn geprägt habe. Eine Herberge sei „ein Ort auf Zeit“, „vom Unterwegssein geprägt“. Weiter sagte Gohl: „Unsere Landeskirche ist an vielen Orten noch immer verlässliche Größe im Ort und pflegt ihren Gebäudebestand. Aber in vielen Gemeinden erleben wir starken Veränderungsbedarf. Gebäude müssen aufgegeben werden, Zugehörigkeit muss sich ständig neu definieren. Für eine Kirche als Herberge sei dies „keine Kränkung, sondern Teil ihrer Existenz“. Kirchenmitglieder würden so „mündige Mitgestalter/innen einer kleiner werdenden Kirche.“
Gohl betonte die Bedeutung der Hoffnung für die Zukunft der Kirche. „Kirche im Umbau“ heiße, „wir haben ein Hoffnungsbild von der neuen Gestalt der Kirche“. Gohl verwies auf das Beispiel der kleinen Waldenserkirche in Italien: „Als Kirche im Umbau können wir von dieser kleinen Diasporakirche Großes lernen: Hoffen und Handeln stehen im Mittelpunkt.“ Eine in der Hoffnung gegründete Kirche auf dem Weg gebe „diesen Segen an andere Menschen weiter und wird zum Segen für andere.“ Wichtig bei allem Umbau sei es, im Kontakt mit Gott zu bleiben: „Entscheidend ist, dass Kirche Gotteserfahrungen ermöglicht und die Menschen, die diese Erfahrungen in ihr machen, nicht in die Abhängigkeit oder Passivität drängt, sondern sie aufbrechen lässt. Darin ist sie ‚Herberge auf Zeit‘.“
Nahost-Konflikt
Neben der Erschütterung über den Angriff der Hamas auf Israel sprach Ernst-Wilhelm Gohl auch das Aufflammen des Antisemitismus in Deutschland an und betonte, es bleibe Aufgabe der Kirchen, „an der Seite unserer jüdischen Geschwister zu stehen. Wie kann es gelingen, jetzt mit Jüdinnen und Juden hier in Deutschland so solidarisch zu sein, dass sie ein Gefühl der alltäglichen Sicherheit zurückgewinnen können […]?“ Gohl sagte mit Blick auf die drohende humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen: „Jedem Menschen, der dort zu Schaden kommt oder gar sein Leben verliert, gehört unser Mitgefühl. Das gilt für alle Opfer in diesem Krieg und natürlich auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Empathie kennt keine Grenzen. Menschenrechte gelten für alle Menschen und sind nicht verhandelbar. […] Wir müssen weg vom ‚ja – aber‘ hin zu einem ‚und‘. Das Leid der Menschen in Israel und das Leid der Menschen in Gaza ist furchtbar.“
Gohl beklagte, auf der einen Seite werde scharf Kritik an Israel geübt. Dabei würden uralte Bilder des Judenhasses aktualisiert. Der israelbezogene Antisemitismus komme von links wie von rechts. Auf der anderen Seite werde jede Form der Kritik an der Politik der israelischen Regierung pauschal als antisemitisch diskreditiert. Kirche habe die Aufgabe, „in einer gewalttätigen und friedlosen Welt für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen.“ Sie solle Gesprächsräume eröffnen, wo „unterschiedliche Positionen zu Wort kommen, ohne die Person, die anders denkt, sofort abzuwerten oder gar niederzubrüllen.“ Deshalb habe sich die Landeskirche gemeinsam mit der württembergischen Diakonie der EKD-Initiative #VerständigungsOrte angeschlossen. Gohl warb dafür, dass Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und die Einrichtungen solche Verständigungsorte schaffen.
Krieg in der Ukraine
Landesbischof Gohl benannte in seinem Bericht klar die Spannung, die in der Landeskirche zwischen unterschiedlichen Haltungen zu Waffenlieferungen für die Ukraine herrsche. Er selbst vertrete nach wie vor die Auffassung, ohne Gerechtigkeit könne es keinen Frieden geben, weshalb Waffenlieferungen gerechtfertigt seien. Zugleich habe er jedoch wiederholt zum Frieden aufgerufen. Gohl betonte, ihm sei es wichtig, dass „die Argumente, die beide Seiten mit Verweis auf Jesus von Nazareth anführen, in unserer Kirche miteinander im Gespräch bleiben.“ Es brauche beide Positionen: „Gesinnungsethisch – Menschen mit einer klaren pazifistischen Überzeugung – und verantwortungsethisch – Menschen, die ihre Position in diesem Konflikt aus den Konsequenzen ihres Tuns ableiten.“ Gohl betonte die Wichtigkeit friedenspädagogischer und präventiver Arbeit. Eine „Kirche im Umbau“, die „die lebendige Hoffnung im Angesicht des auferstandenen Christus ausstrahlt“, wende sich zuerst den Opfern des Krieges zu. Sie bringe ihre Verzweiflung und ihre Angst vor Gott, bitte Gott um Frieden und helfe den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.
Der Streit um § 218
Die von der Bundesregierung geplante Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 StGB kündigt für Gohl den Konsens zum Schutz des ungeborenen Lebens auf, und die Neupositionierung der EKD in dieser Frage führe zu einer einseitigen Schwächung des Grundrechts des ungeborenen Kindes auf Leben. Er betonte, ein abgestufter Lebensschutz werde dem Leben als Gottes Geschenk nicht gerecht, und begrüßte die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Kammernetzwerks der EKD zur Erarbeitung einer gemeinsamen Position.
Demokratie und Rechtsextremismus
Mit Blick auf „unverblümt rechtsextremistische Äußerungen der AfD“ beklagte Gohl die Verrohung der Kommunikation, die die Debattenkultur bedrohe. Tätliche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker (auch auf solche der AfD) seien durch nichts zu rechtfertigen. Die Kirchen hätten sich „klar zur freiheitlichen Demokratie bekannt und gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit positioniert“.
Gohl wiederholte seine theologische Überzeugung, dass „die Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens nicht mit den Werten und dem dahinterliegenden Menschenbild einer rechtsextremistischen Partei wie der AfD zusammenpassen“. Es gehe ihm jedoch nicht darum, „Menschen aus der Kirche auszuschließen, sondern umgekehrt, Christen, die die AfD wählen, zum Nach- und Umdenken zu bewegen.“ Maßstab für eine Prüfung, ob politische Positionen mit dem christlichen Glauben zu verbinden sind, sei die Bibel, in der es immer auch um das Thema Gerechtigkeit gehe: „Es stimmt eben nicht, dass wenn jeder an sich denkt, an alle gedacht ist. Es ist nicht egal, wie es meinem Nächsten geht! Damit haben die ersten Christen überzeugt. Sie haben sich um alle gekümmert: Ob es ein geborener Römer war, ein Christ, ein Jude oder einer, der an heidnische Götter geglaubt hat.“ Da die AfD eine demokratisch legitimierte Partei sei, bedürfe es einer weiteren theologischen Klärung der grundsätzlichen Unvereinbarkeit von Glauben und AfD-Wahl. Gohl verwies dafür auch auf die Barmer Theologische Erklärung.
Gohl hält es für notwendig, für den Umgang mit Vertretern der AfD innerhalb der Kirche, zum Beispiel in kirchlichen Wahlgremien klare Kriterien zu entwickeln, die es bislang noch nicht gebe – „auch als Lernprozess aus der Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945“. Dafür wünsche er sich „in der Synode eine theologische Debatte darüber, welche politischen Positionen mit unserem Verständnis des Evangeliums unvereinbar sind und welche Konsequenzen das für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende hat.
Klimakrise
„Die Klimakrise fordert uns als Christen heraus“, so Gohl. Das „Staunen über Gottes wunderbare Schöpfung mahnt uns, unsere Stimme zu erheben gegen die Zerstörung unserer Erde.“ Man könne das wie beim Klimaappell tun oder in der Bereitschaft zur gesellschaftlichen Debatte mit Aktivisten und Gegnern, sagte Gohl und fuhr fort: „Und wir als Kirche müssen selbst zeigen, dass wir es ernst meinen mit einem nachhaltigen Klimaschutz.“ Gohl wies auch auf die engen Beziehungen zwischen der Klimakrise und der Armutskrise des globalen Südens hin.
ForuM-Studie
Landesbischof Gohl betonte, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche, die Hilfe für die Betroffenen und die Prävention seien ein kontinuierlicher Prozess und die Beteiligung der Betroffenen sei zentral. Er dankte den Betroffenen für ihre Mitarbeit unter anderem bei den bislang vier Betroffenen-Foren.
Den Volltext des Berichts des Landesbischofs können Sie hier herunterladen und lesen:
Weitere Äußerungen von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl zu den Themen seines Berichts
Weitere Äußerungen von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl
Damit Sie nichts verpassen:
Hinweis für Kirchengemeinden
Kirchengemeinden sind herzlich eingeladen, Texte wie diesen von www.elk-wue.de in ihren eigenen Publikationen zu verwenden, zum Beispiel in Gemeindebriefen. Sollten Sie dabei auch die zugehörigen Bilder nutzen wollen, bitten wir Sie, per Mail an kontakt@