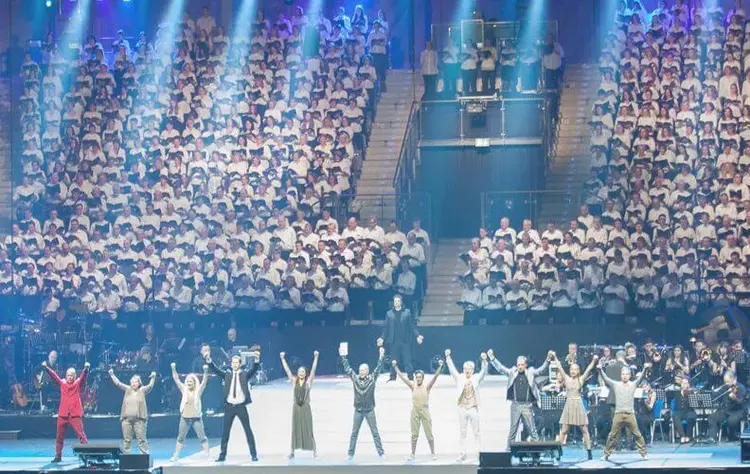30.10.2018
Mut und Demut
Christiane Kohler-Weiß im Gespräch
„Ich glaube, Gott will uns überraschen und es wäre super, wenn wir ihm dazu etwas mehr Gelegenheit geben würden“, sagt Kirchenrätin Dr. Christiane Kohler-Weiß, die Beauftragte für das Reformationsjubiläum der Landeskirche. Ein Jahr nach den Feierlichkeiten hat sich Stephan Braun mit ihr unterhalten und eine Frau erlebt, die für mehr Spaß, Leichtigkeit, Mystik und Risikobereitschaft in der Kirche wirbt und davon überzeugt ist, dass Brückenbauer Demut üben müssen.

Frau Kohler-Weiß, das Reformationsjubiläum liegt ein Jahr zurück. Was ist Ihnen davon in Erinnerung geblieben?
Ich erinnere mich an vieles. Besonders erfolgreich scheinen mir die Veranstaltungen und Projekte gewesen zu sein, die zusammen mit anderen geplant und durchgeführt wurden. Ich denke an die Kooperationen innerhalb der Dekanate oder der Ökumene, aber auch an die Zusammenarbeit mit Museen, Theatern, zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten oder bildenden Künstlern. Da ist viel Bewegung entstanden.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Wenn ein Theaterstück über den württembergischen Reformator Johannes Brenz auf der Freilichtbühne in Schwäbisch Hall gegeben wird, dann zieht das ein anderes Publikum an als ein Vortrag im Gemeindehaus. Und wenn ein bildender Künstler wie Thomas Putze aus Materialien vom Recyclinghof eine Art „Lumpenkirche“ aufbaut, dann werden dadurch andere Fragen aufgeworfen als bei der Besichtigung einer Stadtkirche.
Inwiefern?
Als ich mir diese Installation ansah, traf ich einen kleinen Jungen, vielleicht acht oder zehn Jahre alt. Er fragte: „Was ist das da?“ Und ich sagte: „Komm, wir schauen es mal an. Erkennst du denn irgendetwas?“ Zusammen entdeckten wir eine christusähnliche Gestalt aus Schwemmholz, das Fragment eines Glasfensters, ein altes Harmonium, eine Posaune, ein Holzkreuz, eine Taube und Gräber aus Maulwurfshügeln. Irgendwann schien die Sonne durch das Glasfensterfragment und das Holzgerüst. Der kleine Junge wurde ganz still und flüsterte: „Es ist eine Kirche.“ Ich glaube, der Junge hat in diesem Moment begriffen, dass eine Kirche nicht dadurch zur Kirche wird, dass sie unserem Bild von ihr entspricht, sondern dadurch, dass sie heiligen Momenten Raum gibt.

Was ist von all dem geblieben?
Kaum dass das Jubiläum vorbei war, geriet die Landeskirche in den Strudel der Auseinandersetzungen um die Segnung homosexueller Paare und auf der Ebene der Kirchenbezirke und Gemeinden war an vielen Orten wieder der Pfarr-Plan das alles beherrschende Thema. Es gab kaum Raum zum Nachklingenlassen. Sofort kam das nächste Thema, das dann wieder mit aller Kraft angepackt wurde. Viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch engagierte Ehrenamtliche, scheinen mir erschöpft und ich frage mich: Wo sind in unserer Kirche die Phasen der Freude am Gelungenen? Des Dankes an Gott und an alle, die sich engagiert haben? Wo sind Freiräume, um zu überlegen, wie es jetzt weitergehen soll?
Keine guten Voraussetzungen für den Anspruch „ecclesia semper reformanda“, der ständigen Erneuerung der Kirche, oder?
Warum? Ich will weder Bewährtes schlecht machen noch mich an Krisensymptomen festbeißen. Das führt schnell zur Selbstentwertung, drückt die Stimmung und endet häufig im Alarmismus oder selbstmitleidigem Jammern und laugt die Engagierten aus. Ich will Lust wecken, manches neu zu sehen, Mut machen zum Ausprobieren, Kreativität freisetzen, Gedankenspiele anregen. Meine Leitfrage ist: Wie können diejenigen, die sich für die Sache Jesu engagieren, wieder mehr Freude daran bekommen, mehr Hoffnung, mehr Sinnerfüllung, mehr Spaß und mehr Leichtigkeit?
Ja, wie?
Die Kirche ist im Wandel, weil Gott die Menschen verwandelt, die zu ihr gehören. Sie kann gar nicht anders. Das ist die erste Pointe der Rede von der „ecclesia semper reformanda“. Die Menschen erleben die verwandelnde Kraft des Geistes Gottes in Gottesdiensten und beim Bibellesen. Das ist auch meine Erfahrung. Und doch denke ich, in der Kirche braucht es mehr Orte, wo Menschen geistlich wachsen können. Vielleicht könnte man auch sagen: Es braucht mehr Mystik.

Die Reformation hat auch die Gesellschaft verändert.
Die Menschen in unserem Land haben viele Fragen, und wir tun als Kirche gut daran, ihnen zuzuhören. Jesus hat die Leute immer wieder gefragt: „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ Er ist den Menschen nicht mit der Haltung begegnet: „Ich weiß, was Du brauchst … und habe es natürlich im Sortiment!“ Wir machen in der Kirche oft Angebote, nach denen niemand verlangt hat. Und wenn wir jemanden fragen, dann vor allem die Menschen in unseren Kerngemeinden. Klar sollen wir den Leuten zuhören, die sich in den Gemeinden besonders engagieren, aber auch denen, die nicht zum Gottesdienst kommen, aber zur Gemeinde gehören – deshalb sind Hausbesuche so wichtig – und denen, die gar nichts mit der Kirche am Hut haben: Vereine, Stadtrat, Kulturinitiativen, Feuerwehr, NGOs, Geschäftsleute und, und, und.
Also raus aus der Komfortzone?
In Südafrika habe ich gemerkt, dass viele Verantwortliche in den Gemeinden dort nicht fragten: Wer kommt nicht zu unseren Gottesdiensten? Wen erreichen wir mit unseren Angeboten nicht? Sondern: „Wem an unserem Ort dienen wir noch nicht?“ Serving first – das ist eine Haltung, die mich sehr berührt hat. „Ein guter Gottesdienst ist einer, bei dem die Abkündigungen zur Predigt passen“, sagte mir dort jemand. Das Gemeindeleben muss die Gemeindeglieder darin unterstützen, das was sie am Sonntag hören, auch gemeinsam leben zu können. Und wenn in der Predigt von Gottes grenzenloser Liebe die Rede ist, dann kann es nicht angehen, dass sich alle Angebote der Gemeinde an eine eng begrenzte Zielgruppe richten.
Kirchenrätin Dr. Christiane Kohler-Weiß ist seit 2014 bis zum Jahresende Beauftragte für das Reformationsjubiläum in Württemberg. Von März bis Juni 2018 absolvierte sie ein Kontaktstudiensemester an der Theologischen Fakultät in Stellenbosch/Südafrika.Ab 1. Januar leitet sie die Abteilung „Theologie und Bildung“ im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche in Württemberg.
Sie meinen, die Gemeinden sollten nicht nur ihre Türen öffnen, sondern selber rausgehen?
Ja, hingehen, statt zu uns einzuladen, das ist auch eine der Lehren aus dem Reformationsjubiläum, das die Evangelische Kirche in Deutschland gezogen hat.

Da setzt man sich aus, das birgt auch ein Risiko.
Wenn Gott das Risiko gescheut hätte, wäre Jesus nie geboren. Ich habe neulich einen Vortrag von Patrick Todjeras aus Greifswald über Fresh X gehört. Da werden beherzt neue Formate ausprobiert: Kletterwände in Kirchen, christliche Tattoo-Studios, After-Work-Gottesdienste und vieles mehr. Patrick Todjeras erzählte von einem anglikanischen Bischof, der nach einigen Jahren der Erprobung von Fresh X fragte: „Wie viel Prozent der Projekte gehen schief?“ Die Antwort war: „zehn Prozent“. „Zehn!“, soll der Bischof entsetzt gerufen haben. „Das ist ja viel zu wenig. Das zeigt, wir sind nicht risikobereit genug.“ Ich glaube, Gott will uns überraschen und es wäre super, wenn wir ihm dazu etwas mehr Gelegenheit geben würden.
Das klingt gut, aber wo wir als Kirche ins Risiko gehen, dürfte innerhalb der Landeskirche umstritten sein.
Vermutlich. In unserer Kirche, aber auch in der Gesellschaft wird die Frage immer wichtiger: Wie kann man in guter Weise beieinander bleiben bei konträren Meinungen? Vielleicht hilft es, wenn wir uns daran erinnern, dass die Bibel ein sehr vielfältiges Buch ist, mit allein vier Evangelien. Auch das Urchristentum war ethnisch, kulturell und sozial ein bunter Haufen. Die Einheit in der Kirche kann nur eine „Einheit in Vielfalt“ sein, das heißt eine Einheit unter den Bedingungen der Pluralität.
Die Realität sieht manchmal anders aus.
Deshalb werbe ich dafür, sich darauf zu verständigen, was zur Einheit der Kirche absolut notwendig ist und was verschieden gesehen werden kann, weil Gott den Menschen in verschiedener Weise begegnet. Das Milieu, in dem jemand groß wird, die soziale Anerkennung, die jemand erfährt, das Einkommen und der Bildungsgrad – all das prägt Meinungen, Glauben und Ethos. Um Brücken bauen zu können, müssen Menschen das Bewusstsein von ihrer eigenen kulturellen Prägung entwickeln und aufs Rechthabenwollen verzichten. Man könnte auch sagen: Brückenbauer müssen bereit sein, Demut zu üben.