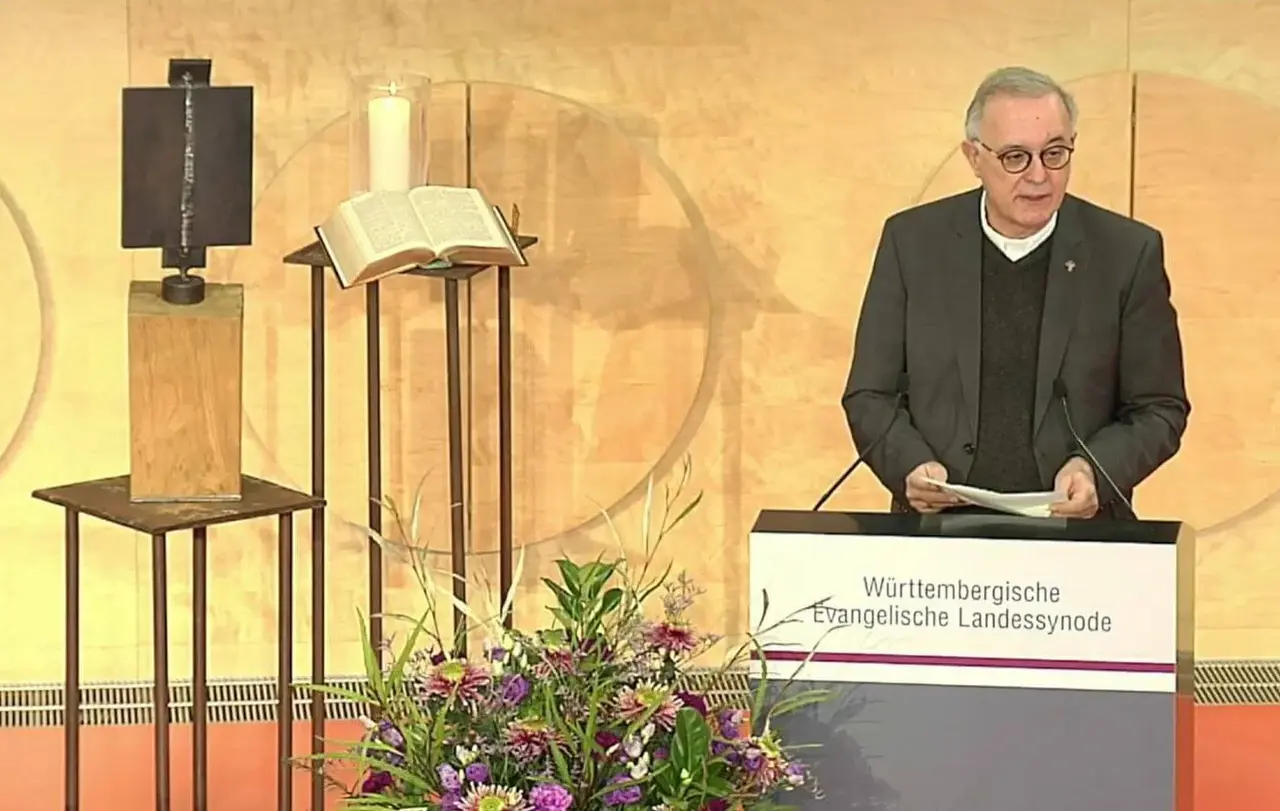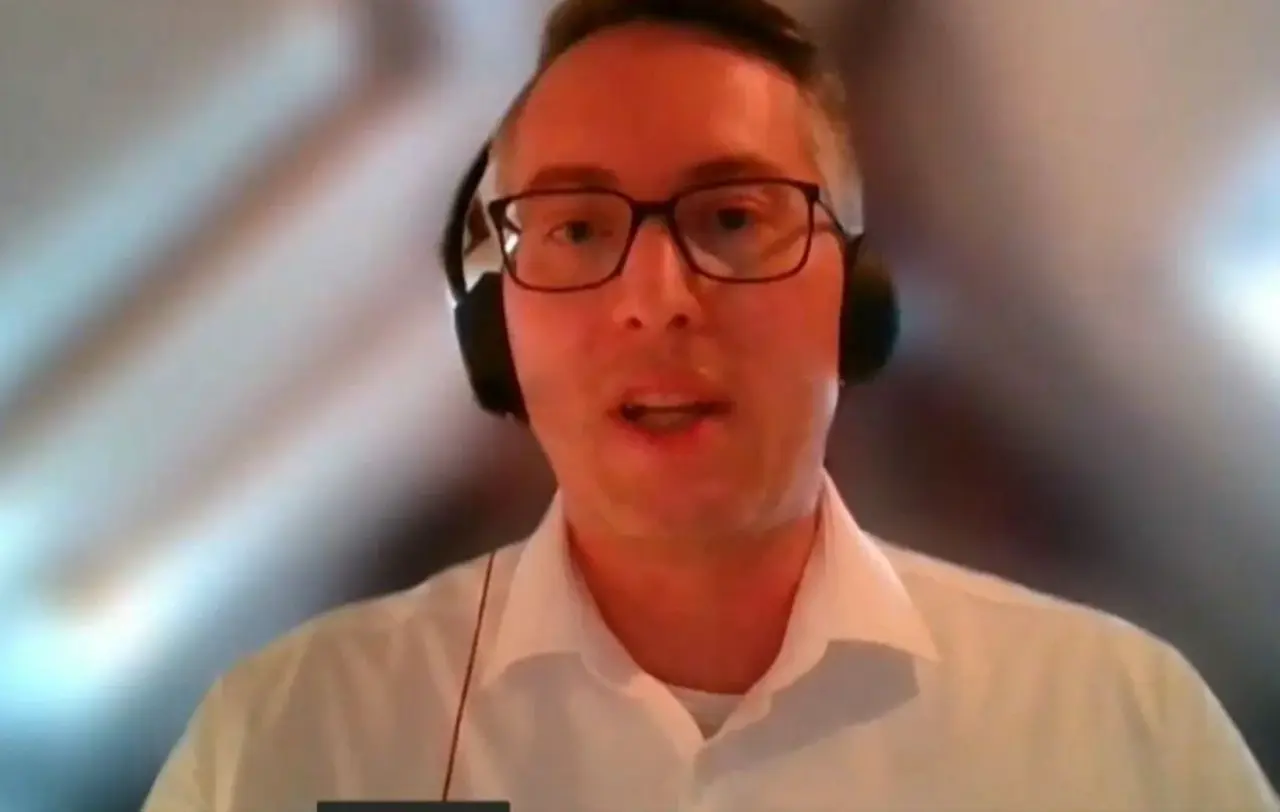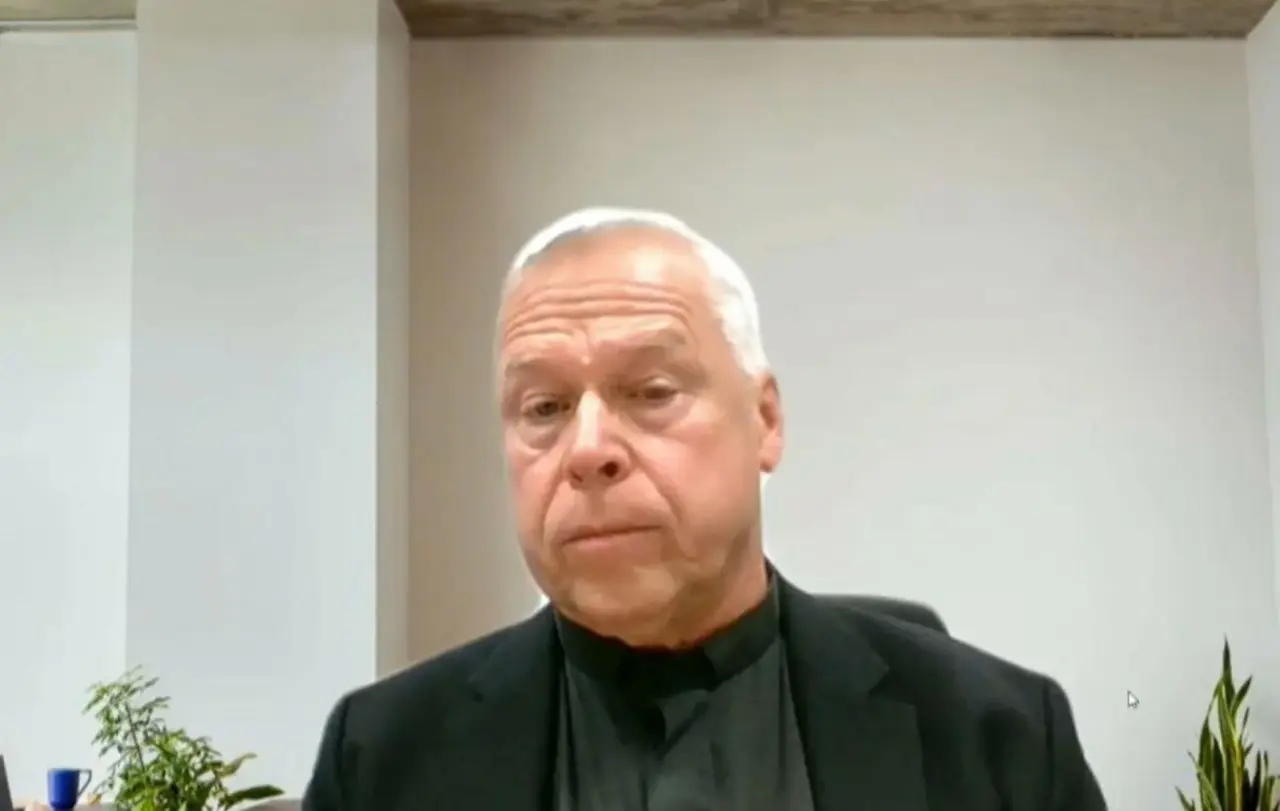TOP 10: Bericht von der EKD-Synode
Über die 2. Tagung der 5. Synode der EKD, die vom 7. bis 10. November auf Grund eines Impfdurchbruchs digital stattgefunden hat, berichten die EKD-Synodalen Annette Sawade und Prof. Dr. Thomas Hörnig:
Bei dieser Tagung stand im Mittelpunkt die Wahl des neuen Rats der EKD und der neuen Ratsvorsitzenden.
Der scheidende EKD Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm berichtete über die zu Ende gehende Amtszeit. Ökumene und interreligiöse Themen sowie die Konsequenzen aus dem Reformationsjahr 2017 waren seine Schwerpunkte. Er berichtete über die Entstehung der Zukunfts-Leitsätze der EKD, äußerte Kritik an zu geringem Vorankommen beim Thema sexualisierte Gewalt. Er kritisierte die weltweit ungerechte Verteilung der Impfstoffe. In einem gemeinsamen ökumenischen Papier sprachen sich die EKD und die Bischofskonferenz für eine europäische Regelung für die Begleitung von Geflüchteten aus.
Präses Anna-Nicole Heinrich berichtete über die vierwöchige #präsestour durch Deutschland. Sie plädierte dafür, nicht nur Vorhaben zu formulieren und auf die Synode hinzuarbeiten, sondern auch unterjährig aktiv zu sein. Hörnig bescheinigt der neuen Präses bei der Leitung der Synode Professionalität und die Präzision eines Schwarzwälder Uhrwerks.
Im Rahmen der anschließenden Aussprachen wurden diverse Themen und Anträge eingebracht, die an die jeweiligen Ausschüsse verwiesen wurden, wie z.B. Klimaschutz, Menschenrechtslage, Impfgerechtigkeit, Kinderarmut, Schließung der ev. Journalistenschule, assistierter Suizid, Demokratiebildung, Digitalität.
Am Ende des ersten Tages folgte der Ratswahlbericht vom Vorsitzenden der Ratswahlkommission. Es waren 22 Kandidaten und Kandidatinnen, eine hatte im letzten Moment zurückgezogen. Es wurden viele Kriterien für eine ausgewogene Beteiligung berücksichtigt.
Am Montag, 8. November fand die Vollversammlung der UEK statt. Der Kirchenpräsident Dr. Volker Jung berichtete in fünf Punkten über Kooperationsverhandlungen, Recht und Finanzen, Theologie und Liturgie sowie Finanzstrategie. Hörnig kritisiert die innerprotestantischen konfessionellen Bünde als „etwas aus der Zeit gefallen“ und berichtet in diesem Zusammenhang über die Bemühungen der UEK sich der EKD als Konvent einzuverleiben.
Das Hauptthema am Nachmittag war der Bericht des Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt durch den Sprecher des Beauftragtenrates, Bischof Dr. Christoph Meyns. Im Bericht werden die Defizite und auch seine Wut über die nicht erfolgte Wiedergutmachung, Ernstnehmen der Betroffenen, Versagen des Betroffenenrates sehr deutlich gemacht. Die sehr persönlichen Berichte von Betroffen schreien nach Lösungen. Seitens der Betroffenen gab es gute Vorschläge, vor allem für den Umgang auf Augenhöhe. Die Vergangenheit muss ohne Schutz der eigenen Institution aufgearbeitet werden. Kirsten Fehrs war bewegt von Kritik. Sie übernimmt die Verantwortung für das „Scheitern des Betroffenenrates“ und sagte zu den Betroffenen: "Wir brauchen Sie".
In der Aussprache ging es um die Fragen:
· Wie geht es weiter, wieso wurden die Anregungen der Betroffenen nicht weiter besprochen?
· In den Anträgen sind wieder nur Synodale dabei, die dann auch befinden, wo können die
Betroffenen ihre Anregungen geben oder sogar entscheiden?
· Das Thema wird die 13. Synode weiter beschäftigen, man brauche eine eigene synodale
Kommission, in der die Betroffenen Mitglied sein sollen, und müsse auch externe Expertise einholen.
· Wieso gibt es diese Gewalt in unserer Organisation Kirche?
Es folgte eine Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Fachleuten und Mitgliedern des Betroffenenrates. Mayns sagte den Betroffenen wissenschaftliche Begleitung und Einbindung zu.
Am Abend folgen Bestätigungen und Umbesetzungen in den ständigen Ausschüssen und die Haushaltsberatungen. „Gespart wird gewaltig. 30% bis zum Jahr 2030. Bei der Frauenarbeit oder der Journalistenschule. Dafür wird in Steine investiert. Das EKD Gebäude in Hannover muss saniert werden“, so Hörnig. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Christian Weyer berichtet über das Haushaltsgesetz und über die Rücklagen. Später fanden dann die jeweiligen Ausschussitzungen statt.
Am Dienstag, 9. November fanden die Ratswahlen statt. Gewählt wurden in neun Wahlgängen (in alphabetischer Reihenfolge):
Andreas Barner, Mitglied im Gesellschafterausschuss Boehringer Ingelheim, Jahrgang 1953, aus Ingelheim am Rhein, verheiratet, eine Tochter, Mitglied im EKD-Rat seit 2015. Der Mathematiker und Mediziner hat sich im Rat in den vergangenen Jahren vor allem mit Haushaltsfragen befasst.
Tobias Bilz, Bischof der sächsischen Landeskirche, Jahrgang 1964, aus Dresden, verheiratet, drei Kinder. Bilz steht seit März 2020 an der Spitze der lutherisch geprägten Landeskirche in Sachsen. Zuvor war der gebürtige Sachse Jugendpfarrer und Dezernent für Gemeindeaufbau, Seelsorge und Medien seiner Landeskirche.
Michael Diener, Pfarrer und Dekan von Germersheim, Jahrgang 1962, aus Germersheim, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied im Rat seit 2015. Diener gilt als Vertreter des Pietismus. Michael Domsgen, Professor für Evangelische Religionspädagogik an der Universität Halle- Wittenberg, Jahrgang 1967, aus Wernigerode, verheiratet, fünf Kinder. Der in Brandenburg geborene und in Sachsen-Anhalt lebende Wissenschaftler will seine Erfahrungen in einer entkirchlichten Region in die Arbeit einbringen.
Kirsten Fehrs, Bischöfin der Nordkirche für den Sprengel Hamburg, Jahrgang 1961, aus Hamburg, verheiratet, Mitglied im Rat seit 2015, stellvertretende Vorsitze ab 2021. Mit der Erfahrung aus der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Bereich der Nordkirche wurde sie erste Sprecherin des Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in der EKD.
Kerstin Griese, SPD-Bundestagsabgeordnete und bisher Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Jahrgang 1966, aus Ratingen, ledig, Mitglied im Rat seit 2015. Die Pfarrerstochter ist seit 2003 Mitglied der EKD-Synode und eine der Sprecherinnen des Arbeitskreises Christinnen und Christen in der SPD.
Jacob Joussen, Jura-Professor an der Ruhr-Universität Bochum, Jahrgang 1971, aus Düsseldorf, verheiratet, Mitglied im Rat seit 2015. Seine Expertise im Bereich des kirchlichen Arbeitsrechts ist in der EKD gefragt.
Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Jahrgang 1960, aus Darmstadt, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied im Rat seit 2015. Jung ist sogenannter Medienbischof der EKD und steht dem Aufsichtsrat des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) vor. Er kündigte an, nur bis zum Ablauf seiner Amtszeit als Kirchenpräsident 2024 Mitglied im Rat zu bleiben. [Dann gibt es Hoffnung für die bisher unberücksichtigte „Südschiene“ der EKD]
Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Jahrgang 1963, aus Bielefeld, ledig, Mitglied im Rat seit 2015. Sie war von 2016 bis 2021 stellvertretende Ratsvorsitzende und übernimmt nun den Vorsitz. Drei Schwerpunkte nannte sie für ihre Arbeit: den Umgang mit dem Klimawandel, die Unterstützung für Schwache und Verletzte sowie die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche.
Silke Lechner, bis Ende Oktober stellvertretende Leiterin des Referats Religion und Außenpolitik im Auswärtigen Amt, Jahrgang 1974, aus Berlin, verheiratet, zwei Kinder. Ab Dezember wird die promovierte Politikwissenschaftlerin beim Ökumenischen Rat der Kirchen die Vollversammlung 2022 in Karlsruhe mit vorbereiten.
Anna von Notz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundesverfassungsgerichts und Mitglied des Redaktionsrats des Verfassungsblogs, Jahrgang 1984, aus Berlin, verheiratet, zwei Kinder. Ihrer Meinung nach müsste die Kirche für Menschen im Spagat zwischen Arbeit, Familie, Freunden und Ehrenamt bessere Angebote machen.
Thomas Rachel, CDU-Bundestagsabgeordneter und bisher Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Jahrgang 1962, aus Düren, verheiratet, ein Kind, Mitglied im Rat seit 2015. Er ist Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der Union.
Stephanie Springer, Präsidentin des Landeskirchenamts der Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Jahrgang 1967, aus Hannover, verheiratet, Mitglied im Rat seit 2015. Die Juristin machte zunächst eine Karriere in der niedersächsischen Landesverwaltung und war Richterin, bevor sie 2013 an die Verwaltungsspitze der hannoverschen Landeskirche wechselte.
Josephine Teske, Pastorin in der Nordkirche, Jahrgang 1986, aus Büdelsdorf, getrennt lebend, zwei Kinder. Teske verbindet ihr Amt als Gemeindepastorin mit der digitalen Kirche. Auf Instagram ist sie als Influencerin unter dem Namen @seligkeitsdinge unterwegs.“
Nicht gewählt, sondern qua Amt im Rat:
Anna-Nicole Heinrich, Philosophie-Studentin, Jahrgang 1996, aus Regensburg, verheiratet. Heinrich war im Mai zur Präses der Synode gewählt worden und gehört dem Rat qua Amt an. Sie steht für eine Gruppe junger Menschen in der evangelischen Kirche, die sich für neue Formen von Verkündigung und insbesondere digitale Kommunikation starkmacht.
Am Abend folgten Berichte des Direktors des Evangelischen Mission - Weltweit (EMW) Rainer Kiefer und Bericht des Friedensbeauftragten des Rates der EKD Renke Brahms.
Am Mittwoch, 10. November fanden Wahlen zum Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz im Rat der EKD. Gewählt wurden Annette Kurschus als Vorsitzende und Kirsten Fehr als Stv. Vorsitzende.
Nach den Berichten von VELK und UEK, Abstimmungen zum Haushalt wurde die Synode mit einem Abschlussgottesdienst beendet.