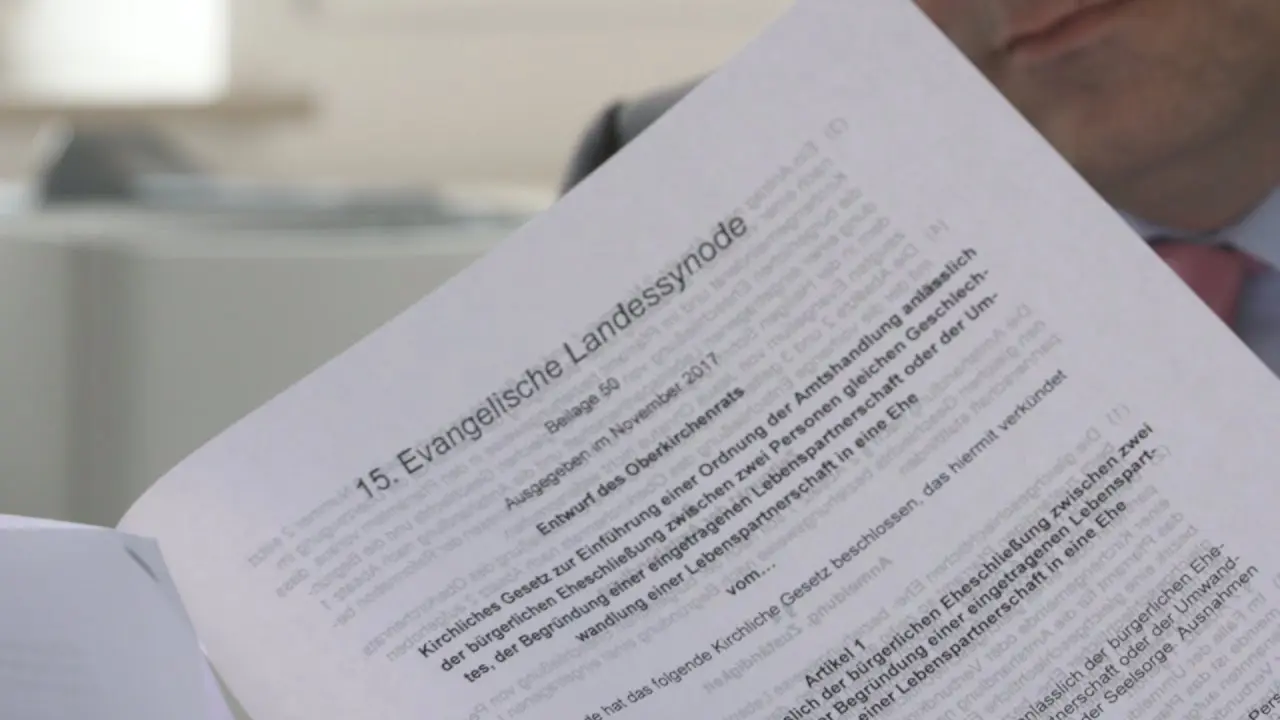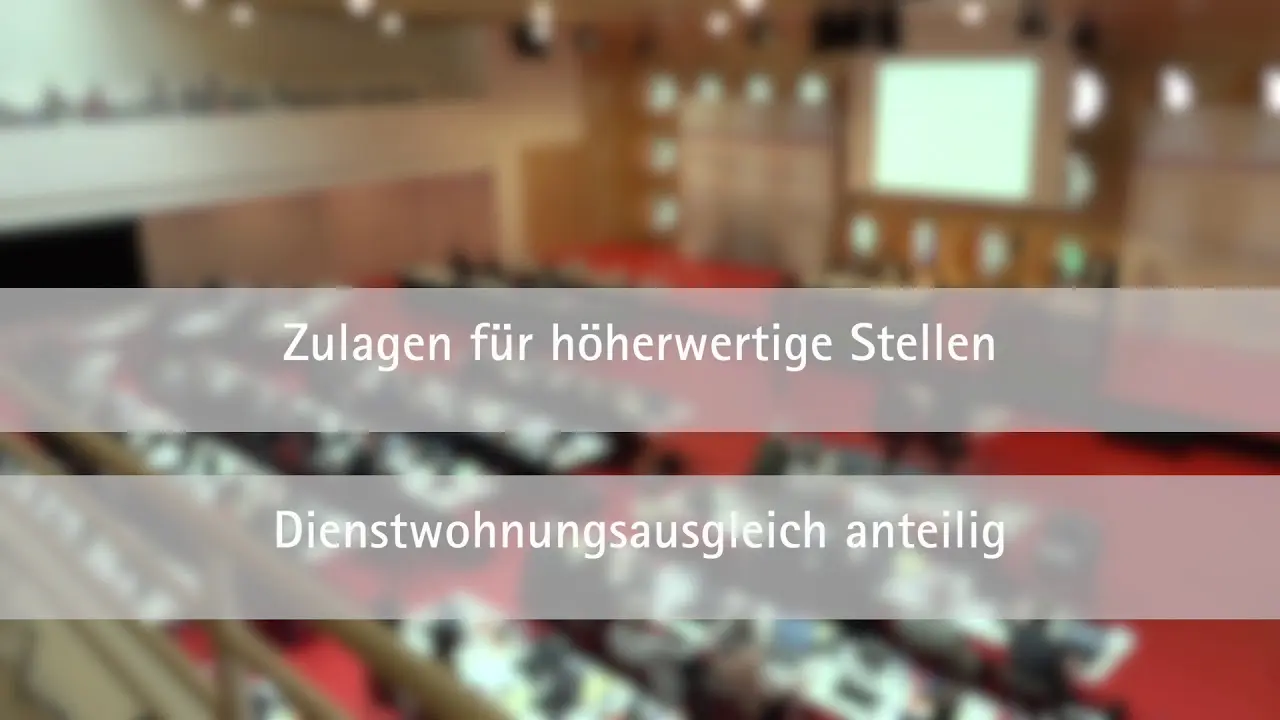Herbsttagung 2017
Vom 27. bis 30. November im Stuttgarter Hospitalhof

1. Sitzungstag - 27. November 2017
Gottesdienst in der Stiftskirche
Mit einem Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche hat am 27. November die Tagung der Württembergischen Evangelischen Landessynode in Stuttgart begonnen.
Top 1 - Wahl Vorsitz des Kirchlichen Verwaltungsgerichts
Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchlichen Verwaltungsgerichtes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Die Wahlen hierzu erfolgten im Rahmen der Herbstsynode 2016.
Der Vorsitzende Richter Dieter Eiche (Vors. Richter am Verwaltungsgericht i.R.) legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dezernat 6a schlägt Herrn Dr. Rüdiger Albrecht zur Wahl als Mitglied des Kirchlichen Verwaltungsgerichts mit Befähigung zum Richteramt und Vorsitzenden des Kirchlichen Verwaltungsgerichts vor.
Aufgrund dienstlicher Verpflichtungen stellte sich Herr Dr. Albrecht bereits am Sonntagabend in den Gesprächskreisen vor. Die geheime Wahlhandlung selbst erfolgt dann am Dienstag.
Top 2 - Wahl und Wechsel in der Mitgliedschaft im Strukturausschuss
Der Synodale Prof. Dr. Plümicke hat mitgeteilt, dass er sein Amt als Stellvertretender Vorsitzender im Strukturausschuss niederlegt und aus diesem ausscheiden wird.
Der Gesprächskreis Offene Kirche hat die Synodale Angelika Herrmann für den frei werdenden Sitz des Strukturausschusses vorgeschlagen. Zeitgleich wird sie ihr Mandat in der Prüfergruppe und im Beirat für landeskirchliche Beteiligungen niederlegen. Derzeit gibt es noch keine Nachfolgerin bzw. noch keinen Nachfolger.
Die Synodale Herrmann wurde in offener Abstimmung einstimmig gewählt. Es gab keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.
Top 3 - Strategische Planung
Die Landeskirche befindet sich auf dem Weg zu einer „vernetzten Kirche“. Vorgezeichnet ist dieser Weg in einer „Digitalen Roadmap“. Denn bei Digitalisierung „geht es nicht nur um IT-Projekte und Apps“, hat Oberkirchenratsdirektor Stefan Werner betont, „sondern darum, neu zu denken und zu verstehen, was Digitalisierung generell und konkret für die Kirche bedeutet“. „Digitalisierung gestalten“ ist einer von fünf Schwerpunkten, die der Oberkirchenrat seit einem Jahr verfolgt. Von dieser Strategischen Planung berichtete Werner gemeinsam mit Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July.
Die weiteren Schwerpunkte lauten „in der Wertediskussion Präsenz zeigen“, „Ehe und Familie stärken“, „das Personalwesen im Oberkirchenrat überprüfen und weiter entwickeln“ und „ein zukunftsfähiges Kommunikationskonzept für die Landeskirche erarbeiten“. Diese Punkte überprüfte der Oberkirchenrat nun und hat sie für das kommende Jahr, teils etwas modifiziert, bestätigt.
Die Schwerpunktsetzung „in der Wertediskussion Präsenz zeigen“ soll dabei mittelfristig beibehalten werden. Auf kirchengemeindlicher Ebene möchte der Oberkirchenrat fortan stärker für dieses Thema werben. Das Maßnahmenpaket „Familie stärken“ soll, vorbehaltlich des erforderlichen Haushaltsbeschlusses, bis 2019 umgesetzt sein. Im Personalwesen möchte der Oberkirchenrat als Arbeitgeber bis 2020 attraktiver und vielfältiger sein als Kommunen. Das Kommunikationskonzept stehe, wie July ausführte, unmittelbar vor einer Beschlussfassung im Kollegium.
Künftig möchte der Oberkirchenrat die strategischen Ziele und Schwerpunktsetzungen der Zukunftsplanung noch enger mit der Landessynode entwickeln. „Das Kollegium wünscht sich im Sinne eines rollierenden Systems eine stetige Begleitung und kritische Diskussion der erarbeiteten Zielsetzungen“, schloss July den Bericht. Zudem erwähnte Werner, dass die Schwerpunktsetzungen, zuvor Jahresziele genannt, der Synode von nun an jährlich im Rahmen der Herbsttagung im aktuellen Stand vorgestellt werden sollen.
Top 3 - Gesprächskreisvoten zur strategischen Planung
In den anschließenden Gesprächskreisvoten monierte Ute Mayer vom Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“ eine fehlende Strahlkraft der Strategischen Planung: „Es geht in Summe viel zu sehr um uns, um die Selbstdarstellung.“ Maike Sachs dachte daher über vertiefte Kooperationen im städtischen Bereich nach, „dass nicht sonntags um 10 Uhr x-mal dasselbe Programm läuft, während sonst die Glocken schweigen“.
Für die „Offene Kirche“ forderte Jutta Henrich mit Blick auf die digitale Strategie des Oberkirchenrates: „Fragen der Ethik und auch die Frage der Arbeitsplätze müssen uns als Kirche beschäftigen.“ Zum Punkt „Ehe und Familie stärken“ ergänzte sie: „Wir stellen fest, dass Familien bunter geworden sind: Da ist auch das lesbische Paar mit einen adoptierten Kind, oder der zum drittem Mal verheiratete Vater.“
Hinsichtlich der Personalplanung erinnerte Eberhard Daferner von „Evangelium und Kirche“: „Auch Kommunen oder staatliche Stellen schlafen in diesem Bereich nicht.“Beim Schwerpunkt „Ehe und Familie stärken“ vermisste er den Bereich Senioren und Kleinkindarbeit: „Ich hätte mir die Aufwertung der Gemeinden gewünscht, die im KiTa-Bereich aktiv sind.“
Zuletzt sprach Tobi Wörner für „Kirche für morgen“. Er forderte eine Fokussierung und Rejustierung: „Uns ist viel anvertraut und manchmal doch verborgen und vergraben unter Tradition, Formen und Gewohnheit.“ Als konkrete Beispiele nannte er unter anderem verschiedene Gottesdienstformen, -zeiten und –stile.
An die vier Gesprächskreisvoten schloss sich eine umfangreiche Aussprache an. Ein darin eingebrachter Antrag des Synodalen Martin Plümicke, der einen eigenen Sprecher für die Landessynode forderte, wurde mit einer Enthaltung in die Ausschüsse verwiesen.
Top 4 - Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes
Die Synode hat einstimmig beschlossen, dass das Strukturerprobungsgesetz bis maximal 2031 in Kraft bleiben soll. Mit diesem Gesetz ist es möglich, Strukturreformen in der Landeskirche zügig umzusetzen. So wurden darüber die Co-Dekanate beispielsweise in den großen Kirchenbezirken Balingen und Ravensburg eingerichtet, die sich bestens bewährt haben. Außerdem ging es um die Gestaltung von Gesamtkirchengemeinden und Strukturierungen von Krankenvereinen und Posaunenchöre. In den nächsten Jahren stehen weitere Reformen der Strukturen an, deshalb soll dies Gesetz weiter gelten.
Top 5 - Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Verwaltungsgerichtsgesetzes
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihre Gesetze verändert, deshalb müssen sie auch in Württemberg redaktionell angepasst werden. Dem stimmte die Landessynode zu. Es geht dabei lediglich darum, dass im landeskirchlichen Gesetz die Verweisungen angepasst werden, sodass im württembergischen Gesetz die richtigen Paragrafen des EKD-Gesetzes zitiert werden.
Top 6 - Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes
In dem Gesetzesentwurf, dem die Landessynode einstimmig, mit einer Enthaltung, zugestimmt hat, geht es um eine punktuelle Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes. Es soll erhebliche praktische Erleichterungen und Verfahrensbeschleunigungen bewirken. Die landeskirchliche Mitarbeitervertretung, das Diakonische Werk und die Arbeitsrechtliche Kommission tragen dies ausdrücklich mit.
Bisher musste – insbesondere bei landeskirchenweiten organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit IT und Finanzen – jede einzelne Mitarbeitervertretung der Dienststellen, die von den Veränderungen betroffen sind, beteiligt werden, was vor Ort zu erheblichen Zeitverzögerungen und zu einem ganz erheblichen Beratungsbedarf führte.
Ziel des Gesetzes ist, dass die Beteiligungsrechte nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz auch in solchen Fällen flächendeckend gewahrt bleiben, in denen der Oberkirchenrat den Dienststellen Vorgaben für die Verwaltungspraxis macht, z. B. bei der Einführung einer neuen Finanzsoftware.
Da die Verantwortung für diese organisatorischen Neuerungen beim Oberkirchenrat liegt, soll auch die Durchführung des Beteiligungsverfahrens auf dieser Ebene angesiedelt werden.
Top 7-8 - Anpassung der Pfarrbesoldung im Blick auf doppelten Dienstwohnungsausgleich
Die Synode hat heute beschlossen, die doppelte Dienstwohnungspauschale abzuschaffen. Wenn ein Pfarrehepaar bislang ein Pfarrhaus bewohnte, wurde von beiden der volle Dienstwohnungsausgleich abgezogen. Jetzt soll für eine Wohnung insgesamt auch nur eine Dienstwohnungspauschale abgezogen werden. Damit wird der Pfarrberuf für Pfarrehepaare attraktiver. Dies hat die Synode mehrheitlich beschlossen.
Ebenso betroffen ist die Krankheitshilfe der Pfarrerinnen und Pfarrer, da sie nicht mehr den Anforderungen an die staatliche Krankenversicherungspflicht genügt. Personen, die bisher Leistungen der Krankheitshilfe des Evangelischen Pfarrvereins in Württemberg e. V. erhalten haben, können nach der Einstellung von deren Geschäftstätigkeit und dem Eintritt in eine Krankenversicherung ein Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen gewährt werden. Hier wurde kein endgültiger Entschluss gefasst. Der Oberkirchenrat wird sich mit den entsprechenenden synodalen Gremien weiter beraten.
Außerdem gibt es eine Anpassung in der Besoldung der Pfarrerinnen und Pfarrer. Wer auf Religionsunterricht verzichtet, soll entsprechend auch weniger Pension erhalten. Dies wurde bereits in der Sommersynode beschlossen. Ergänzt wurde nun, dass die bis zum 31. Juli 2017 erfolgten Verminderungen der Dienstbezüge aufgrund vollständiger oder teilweiser Befreiung von der Verpflichtung zur Erteilung von Religionsunterricht keine Auswirkung auf die Versorgungsbezüge haben.
Auch wird angepasst, dass die Übertragung einer höherwertigen Pfarrstelle erst im mittleren Alter besoldungswirksam wird. Pfarrerinnen und Pfarrer, die schon jung eine mit P 3 bewertete Pfarrstelle innehaben, können eine Zulage erhalten. Diese Möglichkeit der Zulage soll jetzt auch für Pfarrerinnen und Pfarrer geschaffen werden, die eine P 2 – Stelle innehaben.
Der Änderungsantrag Nr. 33/17 wollte diese ganzen Einschränkungen abschaffen und die Pfarrer auf höher bewerteten Pfarrstellen auch von Anfang an der Stelle entsprechend höher besolden. Dies hat im Rechtsausschuss aber keine Mehrheit gefunden. Dessen Vorsitzender Prof. Dr. Christian Heckel sagte: „Die Pfarrbesoldung muss als Gesamtsystem gesehen werden. Dies soll nicht auf einmal grundlegend, sondern behutsam verändert werden“.